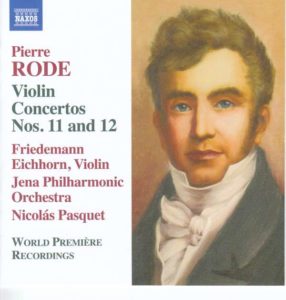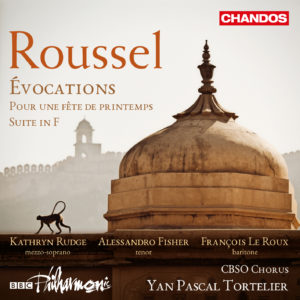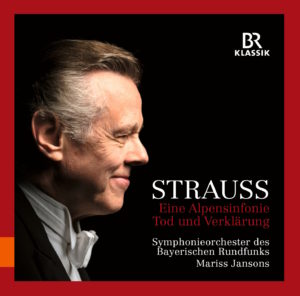Ein mehrtägiges Festival um eine Opernproduktion, das auf einer kleinen Insel stattfindet, etwa vier Stunden Bootsfahrt von der nächsten Stadt entfernt? Das klingt nach einem Abenteuer für mich: Und so mache ich mich erneut auf nach Norwegen, diesmal nach Røst.

Die Reise geht über Oslo nach Bodø, von wo aus die Fähre nach Røst ablegt. Nach etwa drei Stunden auf dem Schiff erhebt sich langsam eine Wand aus den Wogen, befremdlich und unwirklich. Je näher das Boot kommt, desto bedrohlicher wirken die Landmassen, die sich über den Horizont erstrecken. Durch das Teleobjektiv erkenne ich Häuser und allmählich teilt sich die Wand; sie erweist sich als eine Ansammlung unzähliger kleiner Inseln, die gedrängt aneinander aufragen. Røstlandet kommt in Sicht – in großzügiger Entfernung zueinander stehende Holzhäuser und manch eine Betonhalle zur Stockfischlagerung prägen den ersten Eindruck, dahinter erkenne ich die nun im Sommer leeren Holzgestelle, auf denen der Fisch getrocknet wird.
So befinde ich mich also auf Røstlandet, der südwestlichsten Insel der Lofoten. Die geringe Größe und Bevölkerungsdichte wirken für mich als Großstadtmenschen exotisch, doch eben hier liegt auch der Reiz. Weniger als 600 Menschen leben in der Røst-Kommune auf etwa 11 Quadratkilometern, die sich auf weit über 300 Inseln und Schären verteilen. Kleine Binnenseen und Wasserkanäle machen die Landschaft ebenso aus wie Steine und Wiesenflächen: Bäume findet man keine auf Røst, zumindest keine natürlich gewachsenen. Der Blick reicht weit über die Hauptinsel, denn der höchste Punkt befindet sich gerade einmal 12 Meter über dem Meeresspiegel. Auf der Ostseite befinden sich die meisten Häuser, und im Süden bei der Bootsanlegestelle; im Norden liegt eine Kirchenruine und im Nordosten ein Flughafen: wobei ich während meiner Zeit auf Røst nur ein einziges Mal eine Maschine habe starten sehen.

Mich beeindruckt die Mentalität hier in der Abgeschiedenheit. Kriminalität gibt es keine auf Røst, weshalb auch kaum jemand auf die Idee kommt, Wohnung oder Auto abzusperren. Warum auch? Selbst wenn jemand einbrechen würde, käme er – wenn überhaupt – bis auf die Fähre, und nicht weiter. Trotz eines beinahe familiären Zusammenhalts in der Gemeinschaft sind die Einwohner ausgesprochen offen gegenüber ihren Gästen und man findet schnell Anschluss an Gespräche. Natürlich hilft es hierbei wie auch überall sonst, die Landessprache zu können, jedoch beherrschen alle Einwohner auch Englisch und viele sogar etwas Deutsch. Es finden allerdings weniger Touristen nach Røst als auf die anderen Lofoten: Vielleicht aufgrund der Entfernung zu den anderen Inseln, vielleicht aufgrund der verschwindend geringen Größe. Doch es lohnt sich!
Das Querinifestival begann bereits am 1. August, ich stoße erst zwei Tage später dazu. Fünf Tage lang werden verschiedenartige Veranstaltungen angeboten, allen voran vier Aufführungen der Oper „Querini“ aus der Feder Henning Sommerros; doch auch andere Konzerte stehen auf dem Programm, ebenso wie Ausflüge. Ich werde später dazu kommen, was es mit Querini auf sich hat und warum ausgerechnet hier dieses riesenhafte Ereignis stattfindet.

Direkt nach meiner Ankunft steht bereits ein erster Konzertbesuch an: Die ebenfalls von den Lofoten stammende Sängerin Kari Bremnes tritt erstmalig auf Røst auf, wobei sie von Bengt Hanssen begleitet wird. Bremnes gehört zu den bekanntesten Stimmen Norwegens und entsprechend voll wird es in der Querinihalle, die 500 Plätze umfasst. Rein und schlicht trägt sie ihre Lieder vor, singt, wie für sich ganz alleine. Bengt E. Hanssen ersetzt eine ganze Band, indem er seiner Klavierstimme auch zahlreiche Effekte und Klänge anderer Instrumente beifügt. Herrliche Momente beschert uns der Musiker durch sein Joiken: Ein Joik ist ein samischer Gesang, in dem die Töne mehr Bedeutung tragen als die Worte.
Unterhaltsam geht es am nächsten Tag weiter mit Rasmus Rohde, der gemeinsam mit seiner „verdens beste band“ („weltbesten Band“) einige der erfolgreichsten norwegischen Lieder-CDs für Kinder eingespielt hat und zeigt, dass Musik alles andere als öde oder uncool ist. In seinen Liedern erzählt er von interessanten Mahlzeiten, reisenden Ballons, naiven Kuscheltieren und Sommererlebnissen. Er kann auf hohem musikalischem Niveau nicht nur den Kleinen ein Lachen entlocken. Denkwürdig bleibt der Moment, in dem Rohde die Stimmung kurz umschwingen lässt und von einem Flüchtlingskind singt, das seine Reise nicht überlebt hat. Gewagt, aber wichtig, den Kindern im Rahmen solch eines Konzerts diese Thematik näherzubringen.
Wenige Stunden später beginnt die Hauptveranstaltung: die vierte und somit letzte Aufführung der Querini-Oper von Henning Sommerro. Es ist die Geschichte des italienischen Handelsmannes Pietro Querini, dessen Schiff in einem Sturm vom Kurs abkam und sank. Nach langer orientierungsloser Reise strandete eines der Rettungsboote auf Sandøy, einer Nachbarinsel von Røst. Die überlebenden Männer wurden von einheimischen Fischern gefunden und gepflegt, wobei nur der örtliche Priester durch seine Lateinkenntnisse zwischen Italienern und Norwegern vermitteln konnte. Nach drei oder vier Monaten reisten Querini und die übrigen zehn Überlebenden der ursprünglichen 68 Männer zurück nach Italien; mit an Bord nahmen sie große Mengen an Stockfisch, der sich als Proviant für lange Reisen ideal eignet, und brachten ihn mit in die Heimat. Damit war Querini vermutlich der erste, der den Stockfisch importierte und somit eine bis heute bestehende Verbindung zwischen Nordnorwegen und Italien schuf. In den letzten Jahren kam auf Røst die Geschichte um Querini vermehrt in Erinnerung: Zunächst benannte man eine Straße nach dem Seefahrer, dann das Wirtshaus der Insel. Schließlich wurde die Idee geboren, die Aufzeichnungen Querinis über seine Abenteuer als Oper zu vertonen, was durch den Komponisten Henning Sommerro und den Librettisten Ragnar Olsen dann auch geschah und 2012 das Licht der Welt erblickte. 2018 wird die Geschichte nach 2012 und 2014 zum dritten Mal auf die Bühne gebracht, diesmal in neuer Inszenierung.
Die Oper zeigt das Geschehen vom Aufbruch in Venedig bis zu Querinis Rückkehr, wobei ein Kormoran (Soetkin Baptist) als omnipräsente Erzählerrolle fungiert. Die Wahl dieses Vogels wirkt nicht abwegig, er ist Wappentier von Røst und auch in Venedig heimisch. Insgesamt drei Liebesgeschichten durchziehen die Oper: Eine fromme Liebe verbindet Pietro Querini (Magne Fremmelid) und seine Frau (Anna Einarsson) und überdauert alle räumliche und zeitliche Distanz. Auch Bernardo (Eivind Kandal), Mitglied in Querinis Crew, sehnt sich nach seiner Maria (Jeanette Goldstein), die wie alle Frauen in Venedig geblieben ist. Diese wird allerdings von einem neuen Freier umgarnt (Jacob Abel Tjeldberg): Anfangs widersteht sie ihm, doch als die Crew noch immer nicht wiederkehrt und für tot gehalten wird, gibt sie nach. Am Ende kommt Bernardo zurück, und vergibt ihr. Eine dritte Liebesbeziehung entsteht zwischen Nicolo (Ivar Magnus Sandve), dem Diener Querinis, und Igna (Henriette Lerstad), einem Mädchen aus Røst. Obgleich die beiden nicht die Sprache des jeweiligen Gegenübers verstehen, spüren sie eine innere Verbindung. Als Querini aufbricht, um nach Venedig zurückzukehren, muss sich auch das Paar trennen, denn Igna wird auf Røst und Nicolo an Bord gebraucht. Das Ende der Oper zeigt, wie die Crew den Stockfisch in Venedig präsentiert und dort davon überzeugt. Ein Gabelstapler mit einer Palette Stockfisch fährt herein und eröffnet den Blick in unsere Gegenwart, in der noch immer Stockfisch von Norwegen nach Italien gebracht wird, wenngleich in anderen Mengen und mit anderen Mitteln.

Nicht nur die Rollenverteilung erweist sich als aufwendig mit genannten Solisten plus Rollen für Christofero aus Querinis Mannschaft (Magnus Berg), einer Hausfrau auf Røst (Hildegunn Pettersen), einem Fischer (Thomas Johansen) und dessen Tochter (Sofie Alexandra Arntsen), sondern auch das Bühnenbild. Die Szenerie wechselt immer wieder zwischen Italien und Norwegen; teils muss das Geschehen überblendet werden, um eine Gleichzeitigkeit der Handlung auszudrücken. Dies gelingt durch fahrbare Elemente wie ein Kirchenfenster, eine Treppe, eine Gondel oder die Löwensäule, die alle schnell auf die Bühne gebracht und ebenso schnell wieder herausgeschoben werden können. Dem Lebensstandard entsprechend gestaltet sich die Szenerie auf Røst schlichter: Ein großer Felsen prägt das Bild, später ergänzt durch ein Holzgerüst, auf dem der Fisch zum trocknen aufgehangen wird. Eine Videokulisse im Hintergrund erweckt die Bühne zum Leben, sie lässt rasche Übergänge zu und verleiht dem Sturm eine glaubwürdige Wucht.
Musikalisch steht die Querini-Oper zwischen den Stühlen, Henning Sommerro verpflichtet sich nicht einem Stil, sondern integriert unterschiedlichste Einflüsse in seine Musik. Dem Orchester vertraut Sommerro manche modernen Effekte an, die Sängerpartien setzt er konventioneller. Die aus Italien stammenden Rollen entleihen sich ihren Stil dem Belcanto, die norwegischen Partien ziehen ihre Kraft aus folkloristischen Elementen wie Borduntönen, spannungstragenden Intervallen und dem Joik. Liebesszenen stellt Sommerro gerne musicalartig-idealisiert dar, das Duett zwischen Nicolo und Igna könnte beinahe einem Disneyfilm entspringen. Allgemein ließe sich die Querini-Oper als „Hit-Oper“ bezeichnen, so wie es beispielsweise Carmen von Bizet ist: Eine Fülle an eingängigen Melodien schmeichelt dem Ohr, wiederkehrende Refrains gehen ins Ohr und prägen sich ein.
Das klingende Resultat ist herzergreifend. Das Engagement für dieses eine Event, die Aufführung eines wichtigen Moments der Inselgeschichte, und der Zusammenhalt als eingespieltes Team übertragen sich auf den Hörer. Die Mitwirkenden wollen ihr Bestes geben und so tun sie es auch. Bei Voraussetzungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, unterstützen sich alle gegenseitig in einem familiären Umfeld. Besetzt wurden die Rollen durch Profis wie Laien gleichermaßen: Manche der Sänger standen erstmals auf einer Bühne, andere regelmäßig seit Jahrzehnten; und die Erfahrenen spornen die Neulinge an, über ihre Grenzen hinauszuwachsen. Es erstaunt, dass auf einer so kleinen Insel so hohes musikalisches Niveau erklingt. Hervorgehoben sei dabei der Chor, der sowohl das Volk aus Venedig als auch die norwegischen Inselbewohner darstellen muss, jeweils mit der entsprechenden regionalen Färbung des Gesangs. Er steht ausgesprochen häufig auf der Bühne und wechselt in den kurzen Verschnaufpausen auch noch die Kostüme. Auch das Orchester leistet viel, die „Querini Sinfonietta“ unter Torodd Wigum wurde extra für das Festival zusammengestellt; sie erweist sich als gutes Team, das sowohl aufeinander wie auch auf die Sänger aktiv eingeht. Bestechend ist die Rolle des Querini durch Magne Fremmelid, einem sonoren Bass mit durchdringender Stimme und Blick für glänzende Details. Jeanette Goldstein überzeugt als Maria, spürbar fiebert das Publikum mit, als sich ihre Liebesaffäre zuspitzt. Heimliche Hauptrolle der Oper bleibt allerdings Soetkin Baptist als Kormoran: In Erinnerung bleibt sie durch ihre erstaunlich naturnahen Vogelrufe, aber auch durch ihren sinnlich-feinen Gesang von unbeschreiblicher Reinheit. Die aus Belgien stammende Sängerin lebt sich in ihre ungewöhnliche Rolle ein und geht in ihr auf, schauspielerisch wie sängerisch: Dieses Talent ist einer großen Entdeckung würdig!
Nach der Oper schließt sich eine Gala an, in welcher die Musiker von Querini noch Highlights aus anderen Opern darbieten. Die erste Hälfte steht im Zeichen von Bizets Carmen, danach tragen die Sänger noch einige ihrer persönlichen Lieblingsarien vor. Bei Carmen (in norwegischer Übersetzung!) steht vor allem der Spaß im Vordergrund, kecke Scherze und lustige Momente werden in die Musik eigebunden; die zweite Hälfte birgt manch einen Opernschatz, der gewissenhaft und reflektiert dargeboten wird.

Am kommenden Tag schließt das Querini-Festival traditionell mit einem Ausflug nach Skomvær, ein kleines Künstlerparadies südwestlich der Hauptinsel. Mit dem Boot kommen wir an Inseln mit Wikingergräbern vorbei, am „Tor zur Hölle“ und an Sandøy, wo Querini und seine Mannschaft 1432 gestrandet sind. Nur fünf Häuser stehen auf Skomvær, eines davon ist der vielbesungene und -abgelichtete Leuchtturm Skomvær fyr. Künstler aus aller Welt bewerben sich für einen dreiwöchigen Aufenthalt auf diesem Fleckchen Land, wo sie in Abgeschiedenheit arbeiten und sich von der Landschaft sowie dem einmaligen Licht inspirieren lassen können. Während unseres Aufenthalts sehen und hören wir einige der hier entstandenen Kunstwerke inklusive des von den Querini-Solisten vorgetragene Lied „Har du fyr?“ von Ola Bremnes. Bei dieser unbeschwerten Idylle kann ich mir kaum vorstellen, dass diese kleine Meereserhebung im Zweiten Weltkrieg strategisch umkämpft war und schließlich vermint wurde. Heute ist nichts mehr übrig von dieser dunklen Vergangenheit und der Blick auf die benachbarten Inseln und das Meer lässt zurückdenken an die vergangenen Tage. Die Zeit auf Røst wird mir lange in Erinnerung bleiben, alleine schon die Anreise auf der Fähre und die Herzlichkeit der Leute, die gemütliche Lebensführung und gleichzeitig der Ehrgeiz, gemeinsam Großes zu schaffen, und das alles in unverwechselbarer Landschaft und mit dem Gefühl von Freiheit.

[Oliver Fraenzke, August 2018]
(Alle Fotos von: Oliver Fraenzke, August 2018)
Bestellen bei jpc