Am 11. November spielt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg unter Leitung von Johannes Klumpp im Mozartsaal der Donauhallen in Donaueschingen. Neben dem Tango aus der Suite zur Filmmusik „Agonie“ von Alfred Schnittke und Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Rokoko-Variationen A-Dur Op. 33 für Violoncello und Orchester in der heute gebräuchlichen Umstellung und Bearbeitung von Wilhelm Fitzenhagen mit dem Solisten Jakob Spahn steht auch die herausfordernde und zutiefst ernste zehnte Symphonie in e-Moll Op. 93 von Dmitri Schostakowitsch auf dem Programm.
Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg hat sich viel vorgenommen für den Abend des 11. November in Donaueschingen. Ein so langes und schwieriges Konzertprogramm mit Schostakowitschs grandioser Symphonie Nr. 10 als Höhepunkt ist der Hörer normalerweise ausschließlich von einem großen und etablierten Klangkörper aus Berufsmusikern gewohnt, nicht aber von einem Jugendorchester, auch wenn ihm ein so blendender Ruf vorauseilt wie in diesem Falle.
Den Beginn des Abends macht Alfred Schnittkes Tango aus der Suite zur Filmmusik „Agonie“, ein zarter und in feiner Manier zurückhaltender Tanz, der dennoch in eine gewisse Wildheit und in Überschwang gerät, der sowohl mit Melancholie als auch mit innerlichem Drängen durchsetzt das einprägsame Thema in verschiedenstem Licht erstrahlen lässt. Besonders markant natürlich Beginn und Schluss durch die engelsgleiche und fernab erscheinende Celesta, die nach ihren ersten Einsätzen in Tschaikowskys Nussknacker-Suite sowie bei Bartók, Chausson oder Strauss relativ bald vor allem in der Filmmusik Verwendung fand und heute jedem durch „Hedwig’s Theme“ aus der Musik zu Harry Potter von John Williams geläufig ist. Unter Klumpp erhält der Tango einen angenehmen Schwung und verfällt zu keiner Zeit in Überhitzung auch in den lauten Passagen, sondern hält sich stets ein wenig zurück und behält so die von Schnittke vorgegebene Wirkung in der gewollten Passivität, die leicht verlorengehen kann. Der Dirigent Johannes Klumpp schätzt seine Musiker gut ein und weiß genau, welch ein Risiko er ihnen zutrauen kann – und geht dieses ein, indem er direkt zum Erscheinen des Tangorhythmus‘ in eben diesem dirigiert, anstatt die sicherere Variante eines geraden Taktschlags zu wählen. Der Plan geht auf und ermutigt das gesamte Landesjugendorchester zu einer prägnant klingenden und rhythmisch fesselnden Wiedergabe. Durch kleine Soloeinwürfe kristallisieren sich schnell einige besondere Talente aus dem Orchester heraus. Es ist nicht zu erwarten, dass alle jungen Musiker bereits einen sauber auspolierten und abgewogenen Klang haben, doch erstaunlich viele können bereits eben damit überzeugen. Besonders der Konzertmeister der ersten Hälfte, Johannes Ascher, bewies ungeheuere Musikalität trotz jungen Alters: Die Ritenuti in seinen kurzen Soloeinwürfen waren derart innerlich gefühlt und organisch wieder in das Originaltempo zurückführend, wie es teils namhaften Konzertsolisten nicht so bewusst gelingt.
Die Rokoko-Variationen A-Dur Op. 33 für Violoncello und Orchester versetzen den Hörer zurück in das 18. Jahrhundert, wenn natürlich auch mit einem vollkommen romantischen Neuanstrich von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Auch an diesem Abend wird die Version von Wilhelm Fitzenhagen gespielt, dem ansonsten vollkommen vergessenen Cellisten und langjährigen Freund von Tschaikowsky, der ebenfalls recht beeindruckende Musik geschaffen hat, die durchaus eine Renaissance verdient! Fitzenhagen bearbeitete das circa zwanzigminütige Bravourstück ein wenig und stellte insbesondere die Variationsreihenfolge um; in dieser Version verbreitete er es und sorgte damit bis heute dafür, dass fast ausschließlich diese Bearbeitung gespielt wird – auch wenn das fast nie in den Programmen und üblicherweise auch nicht einmal in den Noten ausgewiesen wird. Als Solist des Abends agiert Jakob Spahn, der unter anderem durch den Sonderpreis der Alice Rosner Foundation beim Internationalen ARD-Wettbewerb 2010 in München für Aufsehen sorgte. Spahn vermag vom ersten Strich an einen vollkommen eigenen Ton auf seinem Cello zu erzeugen, der recht rau und volltönend klingt und eine sanfte Wärme ohne übermäßig glatten Klang schafft. Das virtuose Meisterwerk gelingt ihm ohne technische Probleme, bis hin in die höchsten Lagen steigt er mit sauberen Tönen auf und bewältigt alle halsbrecherischen Läufe mit einem unbekümmerten Lächeln im Gesicht. Auch auf musikalischer Ebene beweist Spahn großes Können und kann den Melodiebogen als großes Ganzes erfassen und gliedern. Unverkennbar sieht man ihm die überschwängliche Spielfreude an und hört sie auch, in leicht beschwingtem Tonfall tanzen seine Themen und kommen offensichtlich aus ganzem Herzen. Doch wie bei fast allen Cellisten (und sonstigen Streichern auch) fällt bei Jakob Spahn eine durchgehende Ingebrauchname des Vibrato auf, das standardisiert bei jedem Ton eintritt, der eine gewisse Länge besitzt. Selbstverständlich hilft ein gutes Vibrato zu einem belebten Klang und hat eine anregende Wirkung, aber der Effekt kippt nach und nach ins Gegenteil, wenn er mechanisch übermäßig zum Einsatz kommt. Als Zugabe gibt es noch einmal das Finale der Variationen, diesmal noch geschwinder und mit noch mehr Elan, (wenn auch entsprechend mit einigen kleinen, jedoch verzeihlichen Fehlgriffen mehr), so dass Spahn nun auch die letzten mitreißt bis in die fulminanten und ausgedehnten Schlusstakte.
Nach der Pause erklingt schließlich das Werk, worauf vermutlich sowohl die Musiker als auch das Publikum an gespanntesten gewartet haben, die zehnte Symphonie von Dmitri Schostakowitsch in e-Moll Op. 93. Dieser gewaltige symphonische Koloss mit über fünfzig Minuten Länge ist auf körperlicher wie geistiger Ebene zutiefst anspruchsvoll und erschütternd. Manch großes A-Orchester müht sich teils mit der dichten Stimmvielfalt, den zerrüttenden Themen und dem schreckensgeladenen Ausdruck dieses symphonischen Werks hörbar ab, welches Schostakowitsch 1953 kurz nach dem Tod seines Unterdrückers Josef Stalin (der genau am gleichen Tag wie Prokofieff, am 5. März, verstarb) begann. Üblicherweise wird die Symphonie als Schlussstrich unter die Terrorherrschaft angesehen, wobei Stalin als Thema auftreten und auch die Zeit an sich verbildlicht werden soll, in die sich Schostakowitsch in Form seiner Initialen D-Es-C-H hineingraviert hat. In wie weit dies alles zutrifft, ist nicht sicher, doch ist zweifelsohne das Grauen komponiert, was bei guter Darbietung den Hörer fesseln muss und teilhaben lässt anhand des unmittelbaren musikalischen Geschehens. Gerade für die jüngeren Musiker muss es eine gigantische Herausforderung sein, sich in diese Schwermütigkeit und Reflexionen aus furchtbaren Zeiten hineinzuversetzen, sie zu fühlen und darzustellen – und all dies bei einer technisch für alle Beteiligten nicht zu unterschätzenden Aufgabe. Diese Anforderungen werden, besonders im Hinblick darauf, dass hier ein Jugendorchester spielt, überraschend umfassend erfüllt. Zwar können die jungen Musiker trotz mitreißender Leitung durch Johannes Klumpp die Symphonie auch nicht völlig frei von statisch gleichförmig wirkenden Passagen halten und auch nicht jede wesentliche Stimme tritt vernehmbar in den Vordergrund, doch gestalten sie ihre Phrasen allesamt erstaunlich vielseitig aus und entlocken der Musik detaillierte Farbnuancen. Der viel beanspruchte Bläserapparat brilliert auch in verzwickten Passagen und gerade das Holz zeichnet sich durch eine frappierende Makellosigkeit aus. So erreicht es das monströse Werk, den Zuhörer durchgehend in seinem Bann zu halten und ihn von der ersten dunklen Sekunde bis in die finale auskomponierte Apotheose unwiderstehlich mitzuzerren in alle erdenklichen Bereiche menschlicher Emotion.
Am Dirigierpult steht Johannes Klumpp, selber zur jüngeren Dirigentengeneration gehörend, und bietet all der divergierenden Stimmvielfalt Zusammenhalt. So einen Dirigenten braucht es für solch ein interessiertes und begeisterungsfähiges Orchester! Denn genau das zeichnet Klumpp aus, er reißt mit und begeistert. Er legt keinen besonderen Wert auf eine optisch ausgefeilte Dirigiertechnik, sondern auf seine Wirkung in zentraler Position als Vermittler gleichermaßen von Musik und Enthusiasmus. So stachelt er sein Jugendorchester stets zur Höchstleistung und auch zur energetisch packenden Melodieführung an, damit auch wirklich das frische Musizieren im Vordergrund steht und nicht etwa die Mechanik des Technischen. Und so hat es sich zweifelsohne gelohnt, die lange Anreise aus München auf sich zu nehmen, um dieses beeindruckende und in vielerlei Hinsicht ausnehmend gelungene Konzert miterleben zu dürfen.
[Oliver Fraenzke, November 2015]
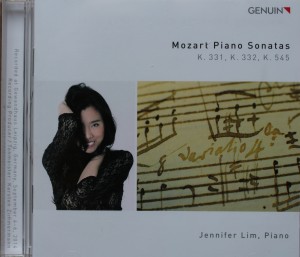

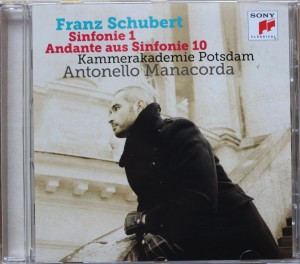
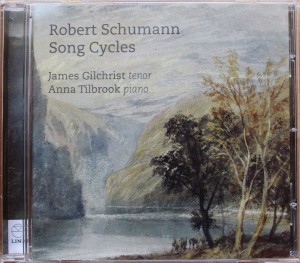
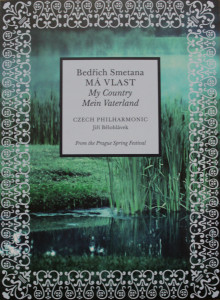

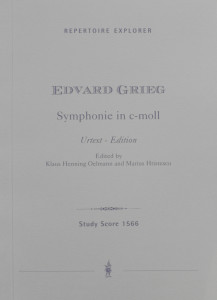
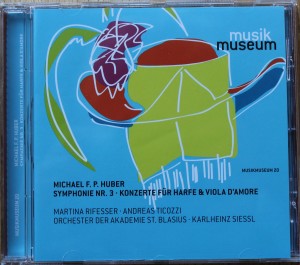



 Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
 Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht
Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht