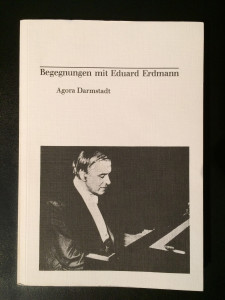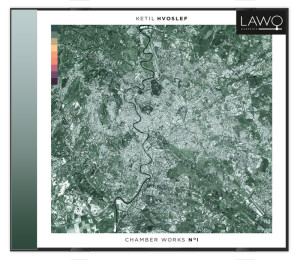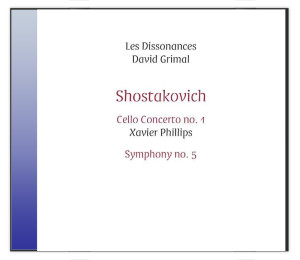Naxos 8.573725; EAN: 7 47313 37257 7
Als Gewinnerin der Jaén International Piano Competition 2015 spielt die 1998 geborene Pianistin Anastasia Rizikov eine CD der Laureate Series von Naxos ein. Auf dem Programm steht die Sturm-Sonate d-Moll op. 31/2 von Ludwig van Beethoven, Triana aus dem zweiten Buch von Albéniz‘ Iberia, Soñando María Magdalena von Juan Cruz-Guevara sowie die Klaviersonate e-Moll op. 7 von Edvard Grieg.
Ich glaube nicht an Wunderkinder. Ich weiß um fingertechnische Begabung, den Nutzen von langem wie intensiv-konzentriertem Üben (und dies begleitend besserer oder schlechterer Unterweisung), und in manchen Fällen ist da ein musikalisches Gespür, welches mit der Zeit immer weiter ausreifen kann. Die meisten jungen Talente verfügen über die beiden zuerst genannten Aspekte, der dritte – und die Arbeit am dritten – bleibt hingegen oft außen vor. Zweifelsohne lässt sich von Anastasia Rizikov behaupten, dass sie alle drei Punkte vereint und schon jetzt zu einer Symbiose verschmelzen lässt.
Noch nicht einmal die Volljährigkeit hatte die kanadische Pianistin erreicht, als sie vorliegende CD einspielte – nach dem Gewinn der Jaén International Piano Competition.
Nur wenige Jahre älter war Edvard Grieg, als er seine einzige Solo-Klaviersonate schrieb, die in gewisser Weise bereits das Klavierkonzert antizipiert, eine volkstümliche Natürlichkeit und Einheit zeigt, als wäre sie aus einem Guss geschaffen (tatsächlich dauerte es nur elf Tage, sie niederzuschreiben). Beethovens Sturm-Sonate entstand parallel zu den Schlusszügen seiner zweiten Symphonie, wobei er auf eine große Anzahl bereits komponierter bedeutsamer Werke zurückblicken konnte. Ein absolutes Reifewerk ist Iberia von Isaac Albéniz, diese zwölf Stücke sind die letzten fertiggestellten Kompositionen des Spaniers, tragen das gesamte Geschick, die ausgeklügelte Tonalität in all ihrer Organik, die spanische Würze und die suggestiv schillernde Farbigkeit seines Stils auf vollendete Weise in sich. Diesen drei Stücken ist hier Soñando María Magdalena von Juan Cruz-Guevara gegenüber gestellt, welches für den Wettbewerb geschrieben wurde, eine sonore Reihe von Variationen über ein Thema, das in vier Stücke unterteilt ist.
Es kann von einer zur Zeit der Aufnahme sechzehnjährigen Pianistin nicht erwartet werden, dass sie die umfassende Form solcher großen Werke in ihrer Gänze einheitlich erfassen kann – selbst den größten Meistern gelang dies noch in späteren Jahren nicht (und man nehme Heinz Tiessens Bericht über den jungen Eduard Erdmann zu Kenntnis – Erdmann ist zweifelsohne einer der größten Pianisten, von dem es Plattenaufnahmen gibt -, in dem er der bereits volljährigen Begabung noch erhebliche Mängel als ausführender wie schaffender Künstler attestierte – nachzulesen in „Begegnungen mit Eduard Erdmann“). Doch dessen ungeachtet gehen Anastasia Rizikovs Fähigkeiten weit über die einwandfreie technisch-mechanische Beherrschung der Werke hinaus. Sie hat eine ausgesprochen lyrische Ader und ein feines Gefühl für melodische Gestaltung.
Gerade bei Beethoven geht ihr Temperament noch manchmal etwas durch mit Rizikov, und das Forte verleitet sie zu aufbrausendem Donnern, welches doch manchmal recht harsch lärmend klirrt. Jedoch vermag sie, die Melodielinien singen zu lassen, und weist ein außergewöhnliches Talent für Phrasierung auf – gerade im dritten Satz kann sie damit begeistern. Ihre vielseitige Anschlagskultur demonstriert Anastasia Rizikov in Albéniz’ Werk, dem sie eine zurückhaltende Farbenpracht verleiht und subtile rhythmische Tanzgebärde. Auch in komplexen, kaum zusammenhängenden Formen wie Cruz-Guevaras Soñando María Magdalena findet sich die Pianistin akkurat zurecht und versucht spürbar, Strukturen zu erspüren. In aller romantischer Pracht entsteht Griegs Solosonate, in die Rizikov sich trotz manch übermäßiger Rubati (im Übrigen ein schwieriger Streitpunkt, da Grieg selbst seine Tempi extrem frei gestaltete, wie in Aufnahmen von 1903 auf Grammophon und 1906 auf Welte-Mignon nachweisbar) wahrhaftig hineinversetzen kann – dieses Werk ist am ehesten „ihre Welt“.
Was Anastasia Rizikovs Spiel einen eigenständigen Status gibt, ist ihr einzigartiger Anschlag, der sofort aufhorchen lässt. Es liegt ein gewisses Gewicht auf jeder Note, und doch ist alles so frei und unbekümmert, also würde ein Schmetterling über die Tasten gleiten. Mittels dieses scheinbaren Paradoxons entsteht eine ganz eigene Magie, ein Wiedererkennungswert im positiven Sinne – wenn Rizikova beginnt, mit ihren Melodien zu singen, verzaubert sie, dann bleibt für Augenblicke die Welt stehen.
[Oliver Fraenzke, November-Dezember 2016]