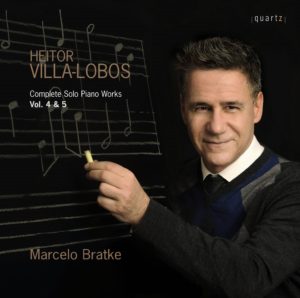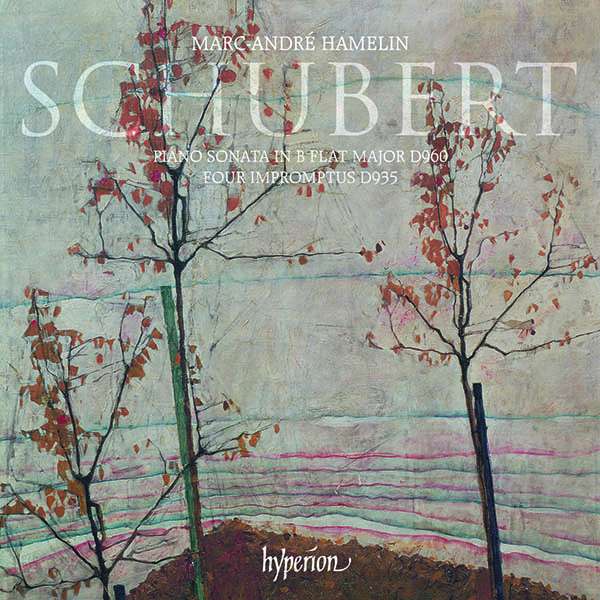Gespräch mit der Pianistin Natalia Ehwald
Eine junge Frau sitzt im Café, hat Notenblätter vor sich auf dem Tisch liegen. Im Hintergrund sitzen Robert Schumann und Franz Schubert am Nebentisch. Ob Natalia Ehwald mit den beiden Herren aus dem 19. Jahrhundert ins Gespräch kommen wird? Fragen hat sie genug. Humorvoll bringt das Booklet-Foto auf der CD den Vorgang einer künstlerischen Annäherung an zwei Giganten der Musikgeschichte auf den Punkt. Das klingende Resultat lässt sich in Schuberts später Sonate A-Dur, D 959 sowie in Schumanns Humoreske opus 20 eindrücklich erfahren.
Stefan Pieper sprach mit Natalia Ehwald über emotionale und intellektuelle Zugänge zur Musik.
Erzählen Sie mir über die Vorgeschichte zu diesem Projekt. Sie haben sich ja schon früh auf diese beiden Komponisten beschäftigt?
Robert Schumanns Klaviermusik war schon früh in meinem Repertoire, ich habe sie von Anfang an gespielt, er hat ja wunderbare Musik für Kinder geschrieben. Schubert kam viel später dazu. Früher habe ich seine Musik nicht wirklich verstanden, vor allem, was sich alles unter der scheinbar heiteren Oberfläche verbirgt. Als junger Mensch hört man das einfach noch nicht richtig.
Heute habe ich gerade bei diesen beiden Komponisten das Gefühl, dass ihre Musik ganz unmittelbar zu mir spricht und ich dies meinem Publikum nahebringen kann.
Die aktuelle Aufnahme ist ja bereits die zweite CD zu diesem Thema. Welche persönliche Weiterentwicklung sehen Sie hier?
Der Prozess der Aufnahme war beim zweiten Mal weniger stressig. Ich wusste eher, wie ich meine Kräfte einteile, so dass auch bis zum letzten Tag noch produktive Energie vorhanden ist. Der Umgang mit dem Tonmeister war lockerer und souveräner. Wie das Ergebnis letzendlich ist und ob es da eine Weiterentwicklung gibt, das können die Hörer besser beurteilen.
Bevorzugen Sie beim Aufnehmen die Detailarbeit oder mögen Sie in einem Bogen runterspielen?
Erst einmal spiele ich natürlich den Satz im Ganzen, vielleicht auch noch ein zweites Mal. Dann schauen wir gemeinsam mit dem Tonmeister: was braucht man noch im Detail? Aber da ist noch ein anderer Aspekt: Am besten wäre es wohl – zumindest phasenweise – noch Publikum einzuladen, so dass man vielleicht einen halben Tag lang mit Zuhörern im Raum spielt. In einer Konzertsituation passiert einfach noch viel mehr, als wenn man nur fürs Mikro spielt.
Sie haben eine sehr charmante Booklet-Gestaltung. Sie sitzen in einem Cafe und am Nebentisch sitzen Franz Schubert und Robert Schumann. Worüber würden Sie mit den beiden gerne reden?
Ich würde ihnen natürlich meine grenzenlose Verehrung aussprechen und für so viel großartige Musik danken. Und natürlich hätte ich Fragen zu ihren musikalischen Ansichten, bei Schumann speziell zu seinen Tempo-Vorstellungen. Schubert würde ich erstmal trösten wollen. Seine Musik ist so tieftraurig, dass man Mitleid bekommt.
Hätten sich die beiden überhaupt untereinander verstanden, was meinen Sie?
Schumann war ein großer Bewunderer von Schubert. Er soll fürchterlich geweint haben, als Schubert gestorben ist. Aber man weiss ja, dass sich große Genies oft nicht besonders gut verstanden haben.
Sie haben die Gefühlstiefe und Tragik von grundauf erfasst. Manchmal so tief, dass die Stellen in Dur sogar tragischer als die Moll-Passagen wirken, was vermutlich nur bei Schubert so funktioniert.
Eigentlich ist Schuberts Musik fast nirgendwo wirklich heiter – und wenn, dann nur, um kurzfristig aus der Misere zu erlösen.
Was gibt diese Musik den Menschen heute?
Ich merke immer wieder, dass Schuberts Musik die Menschen im Tiefsten anrührt. Die Sehnsüchte und Nöte der Menschen sind ja in jeder Zeit ähnlich, und wenn es Komponisten verstehen, mit ihrer Musik den Zuhörer zu bewegen und berühren, dann ist ihre Musik für jede Zeit relevant, ganz gleich, wann sie geschrieben wurde.
Wie verhalten sich emotionale und intellektuell technische Aspekte bei der Erarbeitung?
Das Wichtigste ist, sich ausreichend Zeit zu nehmen – vom ersten Lesen des Notentextes, dessen Analyse, dem Hören von Aufnahmen. Es gibt Phasen, in denen die Arbeit an den Details oder technischen Herausforderungen überwiegt, dann wieder kommt der größere Bogen ins Visier. Bei all dem baut sich auf die Dauer ein immer tieferes, persönliches Verhältnis zum Werk auf. Wenn dies erst einmal vorhanden ist, kann ich im Konzert oder bei der Aufnahme alle Arbeitsschritte vergessen und im besten Fall einfach musizieren, ohne nachzudenken.
Sie haben relativ spät mit dem Aufnehmen von CDs angefangen.
Für mich war damals einfach der passende Zeitpunkt, diese Werke verlangten nach einer intensiven und langjährigen Annäherung, bevor ich das Gefühl hatte, sie einspielen zu wollen. Früh oder spät spielt da für mich keine Rolle.
Beschreiben Sie mal kurz Ihren Werdegang!
Mein Vater ist Dirigent, meine Mutter Musikwissenschaftlerin. Sie hat meinen Klavierunterricht begleitet und dafür gesorgt, dass ich gute Lehrer hatte in den Jahren, in denen man die Hände formt und das Gehör schult, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Später am Gymnasium fühlte ich mich unverstanden von meinen Klassenkameraden, weil ich ständig am Klavier saß und mich mit klassischer Musik beschäftigte, deshalb entschied ich mich, auf eine Musik-Spezialschule zu wechseln. Dabei wollte ich früher in erster Linie Schauspielerin werden, das Theater hat mich damals sehr fasziniert. Dass ich doch Musikerin werde, war dann wohl klar, als ich mit 16 bei einem Meisterkurs meinen künftigen Lehrer Erik Tawaststjerna kennen gelernt habe. Ich bin dann nach Helsinki gegangen, um bei ihm an der Sibelius-Akademie zu studieren.
Warum gerade Finnland?
Letztlich ist die Hochschule und deren Standort egal. Es geht immer darum, bei einem bestimmten Lehrer zu studieren. Auch als ich nach Deutschland zurück kam, suchte ich nur nach dem passenden Professor, den ich letztendlich in Evgeni Koroliov fand.
Natürlich ist ein Leben im Ausland immer eine wichtige Erfahrung für einen Künstler, um eine andere Kultur kennen zu lernen und den Horizont zu erweitern. Nach vier Jahren wollte ich aber zurück nach Hause. Zur Zeit lebe ich mit meiner Familie in Berlin und bin sehr glücklich hier. Das war schon immer ein Ort, an den ich wollte. Das Leben ist hier sehr unkompliziert.
Was kann man, sollte man machen, damit sich mehr junge Menschen für klassische Musik begeistern?
Ganz wichtig ist ein guter, kreativer und inspirierender Musikunterricht. Mein 7-jähriger Sohn hat in der Schule nur eine Stunde Musik in der Woche, warum nicht zwei oder drei? Mein jüngerer Sohn ist im Musikkindergarten, der von Daniel Barenboim gegründet wurde. Die meisten Kinder, die in diesen Kindergarten kommen, machen später weiter mit der Musik. Sie erfahren dort, dass Musik zum Leben und zum Alltag einfach dazugehört, und es wird immer viel gesungen.
Gibt es Ihrer Meinung nach Länder, von denen sich Deutschland eine Scheibe abschneiden könnte, was die Neugier junger Menschen auf klassische Musik betrifft?
Da fällt mir auf Anhieb Asien ein! Dort gibt es eine unglaubliche Neugier auf die europäische Kultur, und eigentlich würde man sich wünschen, dass wir Europäer auf ihre Kultur ebenso neugierig wären.
In China hat mich besonders beeindruckt, wie viele Kinder Klavier lernen, wirklich großartig. Lang Lang hat das mit beeinflusst und es ist sicherlich auch sein Verdienst, dass sich dort so viele Menschen für klassische Musik begeistern.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch!