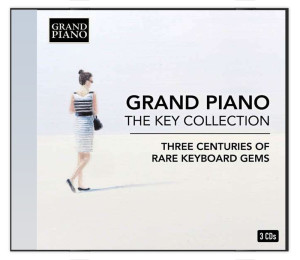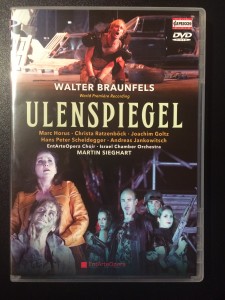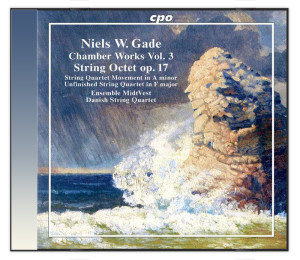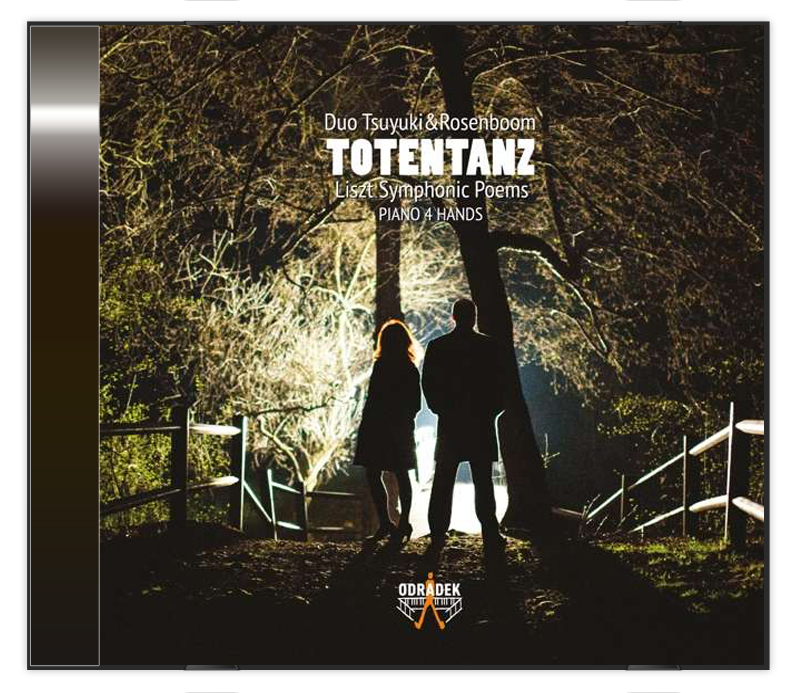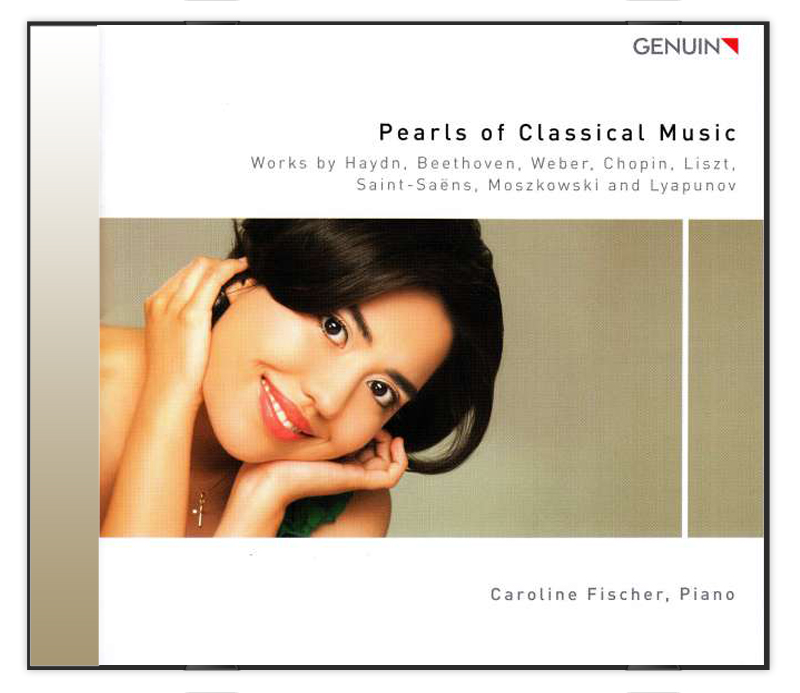Am 5. März 2017 dirigiert Christoph Schlüren im Zeughaus Neuss die Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein mit den Aquarelles op. 43 von John Foulds, eine von ihm und Lucian Beschiu erstellte Streicherfassung von Anders Eliassons Klavierstück Carosello (Disegno no. 3) und Paul Büttners Streichersymphonie nach dem Streichquartett g-Moll. Zudem ist Beethovens drittes Klavierkonzert mit der Pianistin Beth Levin, die ihr Deutschland-Debut als Orchestersolistin gibt.
Es sind Namen, die nicht alltäglich auf den Programmen zu finden sind: John Foulds, Anders Eliasson und Paul Büttner. Gleich drei vergessene oder nie wirklich etablierte Komponisten aus unterschiedlichsten Traditionen und Epochen eint das heutige Programm im Zeughaus Neuss, zusammen mit dem deutschen Orchester-Debut der amerikanischen Pianistin Beth Levin, deren CDs allesamt selten erreichte Qualität repräsentieren, gleich vier Gründe für diese weite Reise von München aus. Es haben sich die richtigen Musiker gefunden für diesen Abend mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein, welche unter ihrem Chefdirigenten Lavard Skou Larsen bereits unzählige missachtete Komponisten auf die große Bühne gebracht haben (diese Saison unter anderem Bernard Stevens, Szymon Laks, Florent Schmitt, Nicolas Flagello und Peter Seabourne), und Christoph Schlüren, dessen zielgerichteter Einsatz für Randrepertoire eine beachtliche Zahl substanzieller Komponisten dem endgültigen Vergessen entreißt.
Nicht nur, dass diese Gegenströmung zu unserer heutigen Verengung des Konzertrepertoires auf immer weniger Standardwerke zu würdigen und zu unterstützen ist, nein auch die dahinter steckende musikalische Erschließung und die Qualität des Konzertvortrags sind überragend.
Die wahrscheinlich größte und erfolgreichste der bisherigen Entdeckungen Christoph Schlürens ist John Herbert Foulds, der um die Wende zum 20. Jahrhundert als Individualist wirkte und verschiedenste Einflüsse mit englischer Volksmusik und indischem Raga kombinierte. Eine Vielzahl an Aufführungen und Einspielungen von Foulds’ Musik sind Schlüren zu verdanken, ebenso die von Lucian Beschiu übernommene Urtextedition in einer bei der Musikproduktion Höflich München erschienene Edition von Foulds’ Werken. Das Programm beginnt mit seinen Aquarelles (Music-Pictures Group II) op. 32, die eigentlich für Streichquartett gesetzt sind. Sunny & Amiable (not frivolous) ist das erste der Stücke, „In Provence. Refrain Rococo“ überschrieben, ein aufgeweckt-heiterer Satz mit herrlicher Melodieführung und ausgewogenem Verhältnis an Gegenstimmen. „The Waters of Babylon“ von 1905 ist das Herzstück der Aquarelles, ein getragener Satz von unvorstellbarer Schönheit, gerade wenn die Wasserspiegelungen durch reflektierende Außenstimmen so bildhaft dargestellt werden, zwischen welchen die Mittelstimmen „not too clearly articulated“ rhythmisch entgegenwirken. In diesem Satz erscheinen auch Vierteltöne von unfehlbarer Wirkung, als würde der Boden wegfallen. Das Finale „Arden Glade. English Tune with Burden“ existiert auch in Klavierfassung, ein heiter springendes Stück, welches Schlüren später noch einmal als Zugabe dirigierte. Klare Tempovorstellungen und Bewusstsein über jede einzelne Stimme und deren Zusammenwirken prägen Dirigat und Spiel. Die Musiker haben Freude an der Musik und das ist unverkennbar, sie können selbst mit dieser nicht bekannten Musik sogleich mitreißen und überzeugen.
Mit leidenschaftlicher Inbrunst begegnet Beth Levin dem dritten Klavierkonzert Ludwig van Beethovens. Sie legt alles in ihren Part, körperlich, intellektuell und emotional ist sie voll beteiligt. Das klangliche Resultat ist überwältigend, selten wirkte Beethoven so unmittelbar, energiegeladen und leidenschaftlich wie am heutigen Tag. Im ersten Satz ist endlich auch einmal die linke Hand ein lebendiger und vollwertiger Widerpart, der zweite Satz ist von unerhörter Getragenheit und klanglicher Auskostung, und das Finale sprudelt so siegreich und enthusiastisch, dass es gar nicht unberührt lassen kann. Das Orchester hat die schwierige Aufgabe hierbei, in der kleinen Streicherbesetzung (die Streicherfassung ist von Vinzenz Lachner) dem großen Steinway standzuhalten und zudem die schwierige Raumakustik auszugleichen – was mit Bravour und einigen dynamischen (für den Hörer Gewinn bringenden) Tricks gelingt.
Als ein Musiker, der sich allen Schubladen und Einordnungen entzog, kann Anders Eliasson bezeichnet werden. Er schuf ein eigenes tonales System, wirkte nach einzigartigen Regeln und hörte auf die Töne selbst, denen er beim Komponieren folgte, sich als Persönlichkeit nach Möglichkeit heraushielt. So entstanden freie und doch stringente Formen im ständigen Fluss – wie er sagte: Musik sei wie H2O, fließend, das habe er „bei Bach“ gelernt. Ein ständiges Voranschreiten und Weiterentwickeln ist auch das Grundprinzip des Disegno no. 3 mit dem Titel Carosello, von Christoph Schlüren und Lucian Beschiu aus der Klavierfassung für Streicher gesetzt. Das Publikum ist für solch eigenwillige Musik erstaunlich aufmerksam und gespannt, nur wenige werden unruhig und eine Person verlässt für die letzten drei Minuten des Werks gar den Raum, eine unnötig störende Geste der Missachtung. Diesen Wenigen sei nachdrücklich geraten, wirklich aktiv zuzuhören und die weichgezeichneten Hörgewohnheiten zu überdenken, denn nur so lässt sich Neues, Ungewöhnliches entdecken. Eben solches wie Eliasson, dessen Harmoniefolgen von so überirdischer Durchschlagskraft sind, dessen Melodien eine ewige Metamorphose durchleben – dessen Musik einen Moment der Unaufmerksamkeit nicht verträgt, und die so tief- und abgründig ist, dass sie ihre Wirkung bei gutem Zuhören eigentlich überhaupt nicht verfehlen kann. Die Streicherfassung des komplexen Carosello wird kongenial aus der Taufe gehoben, die Einzelstimmen sind total aufeinander abgestimmt und der Fluss ist so natürlich und organisch, als wäre es eine Improvisation.
Zurück ins frühe 20. Jahrhundert führt Paul Büttner, der wichtigste Schüler von Felix Draeseke, noch mehr als sein Lehrer aus den Konzertprogrammen verschwunden. Die zu hörende Streicher-Symphonie (nach dem Streichquartett g-Moll) entstammt der Hochzeit des Komponisten, wenige Jahre zuvor entdeckte Arthur Nikisch – damals einer der angesehensten Dirigenten überhaupt – seine dritte Symphonie und Büttner „boomte“. Es entstand neben anderem die vierte Symphonie, die erste Violinsonate und eben besagtes Streichquartett von 1916, allesamt substanzielle Werke in profiliertestem Stil. Der Ruhm hielt nur kurz, spätestens durch die aufsteigenden Nationalsozialisten wurde er aufgrund seiner jüdischen Ehefrau Eva aus den Sälen verbannt. Das Streichquartett zeugt von einem ganz eigenen und unverkennbaren Stil, der sich in die Tradition von Beethoven, Schubert, Bruckner, Brahms, Draeseke, aber auch Strauss und vielleicht etwas Wagner und Mahler eingliedert. Spannend ist seine formale Anlage aus drei Hauptstücken, die durch zwei Zwischenspiele (im übrigen nicht weniger gekonnt oder inspiriert) getrennt werden. Ein ähnliches Prinzip nutzte Büttner später für die in seinen letzten Jahren im Versteck komponierte zweiten Violinsonate, zwischen deren vier Hauptsätzen sich zwei „Auseinandersetzungen“ einfügen. Nun darf das Orchester mehr noch als bei bei Beethoven unter Beweis stellen, auch symphonische Ausmaße formal zu überblicken und als Einheit darzustellen, was unter Christoph Schlüren mühelos gelingt. Die Korrelation der Phrasierung und der Dynamik ist einheitlich und schweißt zusammen, was zusammen gehört. Die Energie wird nicht frühzeitig überstrapaziert und bleibt auch nicht zu lange unten, sie folgt dem musikalischen Strom und passt sich diesem an. Von Willkür ist keine Spur und ebenso wenig von Verstaubtheit oder Trockenheit, die Musik wird aktualisiert und geschieht unmittelbar vor unseren Augen, als würde sie erst gerade entstehen. Unter den fließend weichen Bewegungen Christoph Schlürens, die aus der Körpermitte entspringen und sich in die Arme wie in Antennen fortsetzen, formt sich ein Klang von inniger Ruhe, Bewusstsein und Lebendigkeit – eine Liebeserklärung an die Musik.
[Oliver Fraenzke, März 2017]