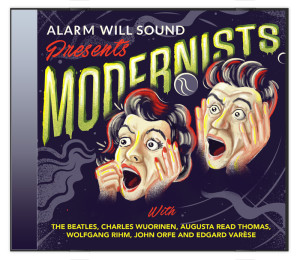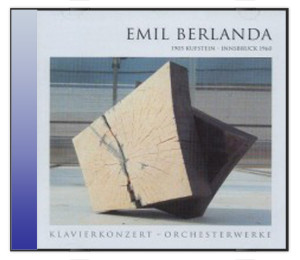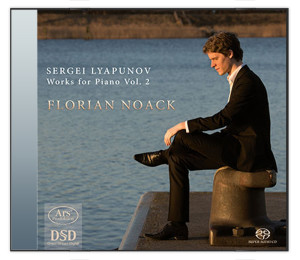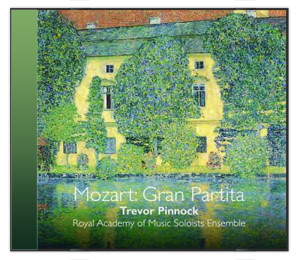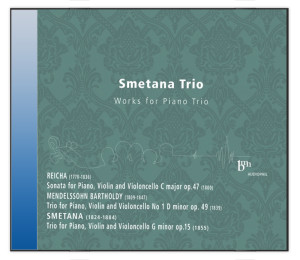Der Berliner Kreis um Eduard Erdmann war Fokus des Symposiums „Im Zeiten-Getriebe“ der Eduard-Erdmann-Gesellschaft e. V. in Kooperation mit der Akademie der Künste in Berlin am 26. und 27. August 2016. In der Akademie am Hanseatenweg Berlin fanden an zwei Tagen Vorträge über Erdmann und einige seiner wichtigsten Berliner Zeitgenossen statt, an beiden Abenden gab es zudem Konzerte mit seiner Musik.
Der 1896 in Riga geborene Eduard Erdmann ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten, weder werden seine großartigen Kompositionen gelegentlich gespielt, noch spricht man weiter von ihm als einem der größten Pianisten und Musiker des vergangenen Jahrhunderts. Bereits zu Lebzeiten galt er als einer der überragenden Pianisten aller Zeiten, er musizierte regelmäßig unter anderem vierhändig mit Walter Gieseking oder im Duo mit der Ausnahmegeigerin Alma Moodie, von deren laut Ohrenzeugen unvergleichlichem Spiel bedauerlicherweise kein Ton in Aufnahmen erhalten ist. Heinz Tiessen hatte in Erdmann seinen ersten bedeutenden und kreativsten Kompositionsschüler vor Sergiu Celibidache. Unmittelbares Erleben, intensivstes Erhören und ein unübertroffenes Gespür für die kadenzierenden Kräfte über lange Strecken prägten Erdmanns Spiel, was zumal in den späten Schubert-Sonaten zu vollendetem Ausdruck kommt. Die begnadet feinfühlige Pianisten Lucy Jarnach, Enkelin des Komponisten Philipp Jarnach (des Schülers von Busoni, engen Freundes von Erdmann und Lehrers von Kurt Weill), nannte Eduard Erdmann neben Arturo Benedetti Michelangeli und Dinu Lipatti als bedeutendsten Pianisten, von dem heute noch Aufnahmen erhalten sind – eine Trias, der zugestimmt werden kann. Doch auch als Komponist schuf Erdmann bedeutsame Werke. Gerade von der Dritten wird oft als einer der ganz großen Symphonien des 20. Jahrhunderts gesprochen – leider ist sie derzeit nur in einer schäbigen Aufnahme unter Israel Yinon erhältlich, der wohl nicht eine einzige Probe vor der Aufnahme ansetzte, und dem auch das Wissen um Phrasierung und Spannungsentwicklung vollständig fehlte. Neben Erdmanns vier Symphonien sind unter anderem noch die Monogramme, die Capricci, das Klavierkonzert sowie das Klavier-Konzertstück, das Ständchen für kleines Orchester (mit dem Titel war Erdmann später unglücklich, da er zu „harmlos“ klang für diese Musik), ein Streichquartett und die symphonisch angelegte Sonate für Violine Solo zu nennen.
Im Berliner Symposium „Im Zeiten-Getriebe“ der Eduard-Erdmann-Gesellschaft e. V. in Kooperation mit der Akademie der Künste ging es nicht um ausführliche biographische Details oder intensive Werkanalyse, hier wurde hauptsächlich gesprochen von dem großen Kreis, den Erdmann in Deutschlands Hauptstadt um sich hatte, über ihn und seine Lehrer, Freunde und Kammermusikpartner. So konnte ein umfassendes Bild der vielseitigen Persönlichkeit Erdmanns entstehen und der Hörer erfuhr Hintergründe und Aspekte des Lebens eines außerordentlichen Künstlers, die in dieser Ausführlichkeit der Zeitzeugenschaft selten sind. Seine unschätzbare Bibliothek, sein umfassendes Wissen quer durch alle Bereiche bis hin zu seinen familiären Umständen wurden thematisiert. Persönliche Begegnungen mit direkten Nachkommen Erdmanns und sogar noch mit ehemaligen Schülern und Freunden des 1958 Verstorbenen ergänzten dies in authentischer Weise.
Den Startschuss machten kurze Begrüßungen des Leiters der Akademie der Künste Werner Grünzweig, welcher eine konzentriert-informierende allgemeine Einführung in das Symposium gab, und dem Vorsitzenden der Eduard-Erdmann-Gesellschaft Horst Jordt, der die wundersame Welt der Irene Erdmann, der Gattin des Meisters, beleuchtete. Sie war ebenfalls eine Künstlerin von Rang – wenngleich sie ihre Gemälde nicht ausstellen ließ – und ermöglichte es überhaupt, dass ihr Mann sich so intensiv mit der Musik und seinen Büchern beschäftigen konnte, während sie die Aufgaben der Kindererziehung wie der Briefkorrespondenz übernahm – allgemein gesprochen, den konstanten Kontakt zur Außenwelt hielt. Eine allgemeine Einführung in das Symposium gab der zweite Vorsitzende Gerhard Gensch.
Den ersten großen Vortrag hielt Christoph Schlüren über „Symphonische Formung in freitonaler Linearität“, womit er das subtil-künstlerische Verhältnis zwischen Erdmann und seinem Lehrer Heinz Tiessen auf musikalisch-ästhetischer Ebene offenlegte. Schlüren sprengte sein Thema, erklärte als zentralen Punkt seines Beitrags auf bislang unerhörte Weise die Phänomene der sogenannten Dodekaphonie, welche er als rein theoretisch funktionierendes Konstrukt beschrieb, im Gegensatz zu der freitonalen Musik Erdmanns, Tiessens und anderer. Auch der Begriff „Atonalität“ wurde angesprochen und verworfen, da auch in der seriell komplexesten Tonorganisation Quintbeziehungen entstehen, die für kurze Zeit tonale Zentren schaffen, welche nur – ebenso wie auch bei Regers kaum durchdringbar mäanderndem Dauer-Modulieren auf engstem Raum – stets schnell wieder entgleiten. Anhand von sechs Tönen Erdmann-Musik ließ er Spannungsverhältnisse verstehen und miterleben. Der Vortrag Schlürens war zweifelsohne für Fachpublikum mit Vorkenntnissen ausgelegt und einige anwesende Nichtmusiker dürften von dem geballten Inhalt eher verschreckt worden sein. Doch wer über allgemeines Wissen über essenzielle musikalische Grundlagen verfügt und sich auch der eigenwilligen, dem „Mainstream“ diametral entgegengesetzten Ansicht ohne Insistieren auf konventionellen Akademismus öffnen konnte, durfte hier eine faszinierende Welt entdecken und einen heute kaum begangenen Weg mit-erkunden, Musik zu verstehen und aus den subtilen Spannungsverhältnissen heraus zu hören und zu erleben. Hier wird ein neuer, wenngleich absolut natürlicher Zugang zur Musik gebahnt, der ununterbrochen aktive Wahrnehmung erfordert, den Hörer dadurch aber unweigerlich belohnt. Es entsteht ein Verständnis von der Musik, die sich von Mechanisierungen löst, jede Tonkombination und somit jede Phrasierung wird einzigartig und muss für sich individuell erspürt werden. Und dies wurde hier erklärt anhand von Beispielen von Tiessen und Erdmann – und wer aktiv mitging, wird die Beziehung der Komponisten intensiver begriffen haben als es ein rein biographisch arbeitender Vortrag je auch nur ansatzweise es hätte vermitteln können.
Volker Scherliess hätte über die Beziehung zwischen Eduard Erdmann und Artur Schnabel sprechen sollen, doch erkrankte er und musste Werner Grünzweig seinen Text „Hüten Sie sich vor Geschicklichkeit!“ anvertrauen, der sich auf eine Warnung Schnabels an seinen Schüler Erdmann bezieht. Auf umfassender Quellenlage beruhend beschrieb Scherliess – durch Grünzweig eindringlich vorgetragen – auch private Aspekte des freundschaftlichen Lehrer-Schüler-Verhältnisses und lieferte ein detailreiches Bild vom Zusammenwirken zweier großartiger Pianisten bis hin zu Erdmanns teilweiser Aufführung von Schnabels als Jugendsünde abgestempeltem und nicht zur Aufführung gedachtem Klavierkonzert unter Pseudonym eines unbekannten Komponisten.
Der zweite Symposiumstag wurde eingeläutet von einer kurzen Einführung durch Manfred Schlösser, welcher trotz vollständiger Ertaubung auf unwahrscheinlich eloquente Art in das von ihm gemeinsam mit dem bereits verstorbenen Christof Bitter herausgegebene Buch „Begegnungen mit Eduard Erdmann“ einging und einige besondere Passagen herausfischte. Es war zutiefst beeindruckend, wie Schlösser trotz des Handicaps nicht nur stringent und charmant vortrug, sondern durchgehend präsent war, die Beiträge der anderen mitlesend und via Diktier-App kommunizierend. Hier stand eine Legende der Erdmann-Forschung vor uns, dessen Buch mit substanziellen Beiträgen aus Erdmanns Umfeld weit mehr als ein Must Have für jeden ist, der sich mit der Person oder dem Künstler Erdmann beschäftigen will. Dies ist wirklich eines der schönsten, vielseitigsten und umfassendsten Bücher der gesamten Musikliteratur (sowie Leitquelle für die meisten gehaltenen Vorträge), eine Besprechung wird in Bälde auf The New Listener erscheinen.
Dem folgte ein Vortrag über den „eigenwilligen Trabanten“ Hans Jürgen von der Wense, der nach seinem Umzug nach Berlin 1920 gerade mit Erdmann und Krenek eine intensive Freundschaft pflegte. Von der Wense darf schlichtweg als Universalgelehrter gelten, er war neben seinen schriftstellerischen Fähigkeiten ein ambitionierter Komponist und Übersetzer aus allen möglichen Sprachen, von welchen er Dutzende beherrschte, zudem war er leidenschaftlicher Pilot und Wetterkundler. Reiner Niehoff (ausnahmsweise ohne Mitwirkung seiner Frau Valeska Bertoncini) brachte den Hörern das ungewöhnliche Leben von der Wenses, seine unverwechselbaren Eigenheiten und seine Verbindung zu Erdmann auf humorvolle und sympathische Weise näher – das Publikum war gebannt von seinen humoristisch-legeren und zugleich sachlich-informativen Ausführungen.
Zugegebenerweise verstehe ich nicht, warum es in diesem Rahmen einen Vortrag über den expressionistischen Maler George Grosz gab, stand er doch vermutlich – obgleich sie Zeitgenossen waren und in der selben Stadt lebten – nie in Kontakt mit Eduard Erdmann, doch hat auch Birgit Möckels Beitrag über ihn das facettenreiche Bild über Erdmann um einen weiteren wichtigen Zeitgenossen bereichert, dessen Kunst das Zeitgeschehen der Weimarer Republik auf einmalige Weise portraitierte.
Anhand des Briefwechsels zwischen Artur und Therese Schnabels eröffnete Julia Glänzel den Zuhörern persönliche Beobachtungen über Eduard Erdmann als Mensch und als Künstler, gab private und nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Aussagen preis über einzelne Konzerte oder allgemein über die nachlässige äußerliche Erscheinung Erdmanns, dem beispielsweise sein Kleidungsstil vollkommen egal war, was wohl immer wieder für Befremdlichkeiten sorgte. Ergänzend zu den Berichten von und über Artur Schnabel spielte die ausgezeichnete Geigerin Judith Ingolfsson Ausschnitte aus der riesenhaften Soloviolinsonate Artur Schnabels.
Der letzte Beitrag beschäftigte sich mit Eduard Erdmanns Geigenpartnerin Alma Moodie, die als Wunderkind schon in frühestem Alter Max Reger begegnete und Carl Flesch vorspielte, dessen Schülerin sie später werden sollte. Ihr Spiel, von dem keine Aufnahmen erhalten sind, wurde anhand von Pressestimmen beschrieben, und die Referentin Birgit Saak betrachtete auch das Repertoire von ihr und Erdmann, welches sie in ihren beiden Phasen kammermusikalischer Kooperation (unterbrochen durch Erdmanns Umzug nach Köln und die Schwangerschaft der früh verstorbenen Violinistin) einstudierten.
Beide Symposiumstage wurden abgerundet von Konzerten, die zum großen Teil dem Komponisten Eduard Erdmann gewidmet waren. Am Freitag spielte Vladimir Stoupel am Klavier mit den Sängern Anna Gütter, Dirk Mestmacher und Jiří Rajniš Auszüge aus der Fragment gebliebenen Operette „Die entsprungene Insel“ op. 14. Trotz abstrusem Handlungsplot und einem eher weniger gelungenen Libretto schuf Erdmann hier Musik von großer Güteklasse, die Klavierstimme lässt eine geistreiche Instrumentation erahnen, und die Sänger fliegen in feingliedrigen Melodien von einzigartigem Charme. Stoupel ist ein Meister darin, kleine Ungenauigkeiten unauffällig zu kaschieren. Die Sänger leitete er verständlich an, und so gelang es, die fragmentarische Aufführung zu einem lohnenden Erlebnis werden zu lassen. Beeindruckend war die sängerische Leistung, die ungeachtet der Begleitung durchgehend ansprechend war. Am Samstag spielte Stoupel mit seiner Frau Judith Ingolfsson die Violinsonate von Heinz Tiessen und die Kreuzersonate Beethovens, die Geigerin spielte alleine die hochkomplexe und fast nie gespielte Soloviolinsonate Erdmanns, deren Intervallverhältnisse so schwierig auszuhören sind, dass bereits einige renommierte Solisten nichts mit ihr anzufangen wussten und sie aus oberflächlichem Unverständnis ablehnten.
Zweifelsohne lernte das Publikum sehr viel über den Pianisten, Komponisten und Menschen Eduard Erdmann, und wohl jeder ging bereichert aus diesem Symposium heraus. Ein weitreichendes Bild Erdmanns und seines Berliner Kreises wurde vermittelt aufgrund liebevoll detaillierter Beschreibungen. Sehr darf man sich auf den Symposiumsbericht mit allen Beiträgen freuen, um sie sich noch einmal genauer zu Gemüte führen zu können. Nächstes Jahr tagt die Erdmann-Gesellschaft in der lettischen Hauptstadt Riga, der Geburtsstadt des Komponisten und Pianisten – sicherlich ein guter Grund, dieser Stadt einen Besuch abzustatten!
[Oliver Fraenzke, August 2016]