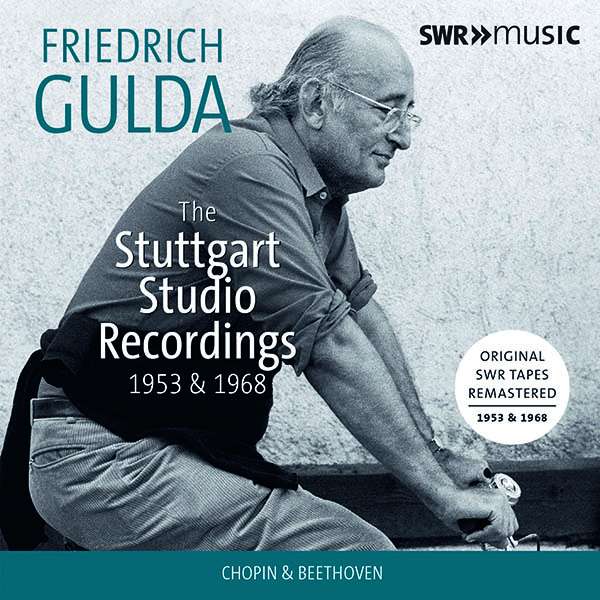Aldilà Records, ARC 022; EAN: 9 003643 980228

Auf seinem bei Aldilà Records erschienen Russischen Album präsentiert der Pianist Andrea Vivanet Stücke russischer Meister aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Es beginnt mit Präludium und Fuge gis-Moll op. 29 von Sergej Tanejew und schließt mit den 24 Préludes op. 34 von Dmitrij Schostakowitsch. Verbunden werden sie durch drei Zyklen von Nikolai Tscherepnin, die hier erstmals eingespielt worden sind: Six Préludes op. 17, Cinq Morceaux op. 18 und die auf Volksliedern basierenden Primitifs.
Zu den Markenzeichen von Aldilà Records gehört die wohlüberlegte Zusammenstellung der einzuspielenden Kompositionen. Die Programme gleichen Vortragsfolgen von Konzerten. Sie bringen Werke verschiedener Komponisten zusammen, die nicht selten unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen entstammen, wobei stets darauf geachtet wird, dass Gemeinsamkeiten deutlich werden, sich zwischen den einzelnen Stücken ein Netz von Beziehungen entspinnt. Wiederholt fanden sich dabei vielgespielte Werke mit solchen kombiniert, die bislang noch gar nicht auf CD vertreten waren und nun zeigen konnten, dass sie neben den bekannteren sehr wohl zu bestehen vermögen. Ebendieses Konzept prägt auch das Russische Album des Pianisten Andrea Vivanet.
Das Album lässt drei russische Komponisten aus drei aufeinander folgenden Generationen zusammentreffen, wobei der Reiz darin besteht, dass die Werke zeitlich näher beieinander liegen, als es die Lebensdaten ihrer Autoren vermuten lassen: Sergej Iwanowitsch Tanejew (1856–1915) ist zwar der an Jahren älteste Komponist, doch sein Präludium und Fuge gis-Moll op. 29 entstand erst 1910, mehrere Jahre nach den Six Préludes op. 17 (1900) und den Cinq Morceaux op. 18 (1901) seines jüngeren Zeitgenossen Nikolai Nikolajewitsch Tscherepnin (1873–1945). Dessen 1926 komponierter Zyklus Primitifs. 12 Adaptions d’anciennes mélodies russes geht den 24 Préludes op. 34 von Dmitrij Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906–1975), der mehr als drei Jahrzehnte nach Tscherepnin geboren wurde, um lediglich sieben Jahre voraus. Wir haben also ein Bündel von 49 Stücken vor uns (48, zählt man Tanejews Präludium und Fuge als ein einzelnes), die innerhalb von nur 33 Jahren entstanden und bei denen es sich teils um Frühwerke, teils um verhältnismäßig späte Werke der jeweiligen Komponisten handelt.
Dass das Programm des imaginären Konzerts sehr abwechslungsreich geraten ist, erscheint bei dieser Konstellation kaum verwunderlich. Zugleich wird deutlich, welch unterschiedliche Arten musikalischer Ausdrucksweisen innerhalb eines recht kurzen Zeitraums nebeneinander existierten. Vivanet bietet sozusagen eine kurzgefasste Überblicksdarstellung zur russischen Klavierminiaturistik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Sergej Tanejew war der große Poeta doctus der russischen Musik, ein tief empfindender Künstler, dessen leidenschaftliche Liebe zum kontrapunktischen Gestalten nahezu seinem gesamten Schaffen das Gepräge gibt. Die Fuge war ihm, im Gegensatz zu manchem Zeitgenossen (innerhalb wie außerhalb Russlands) kein Demonstrationsobjekt akademischer Gelehrsamkeit, sondern ein tondichterisches Ausdrucksmittel, das er regelmäßig dazu nutzte, im Schlusssatz eines Werkes die Musik zu maximaler Spannung zu steigern. Obwohl in jungen Jahren als einer der besten Pianisten Russlands gerühmt (Pjotr Tschaikowskij betraute ihn mit Ur- und Erstaufführungen seiner Klavierkonzerte), hat Tanejew relativ wenig für Soloklavier geschrieben. Das einzige dieser Werke, dem er eine Opuszahl zugestand, ist zugleich das späteste: Präludium und Fuge gis-Moll op. 29.
Während Tanejew bis zuletzt der traditionellen Dur-Moll-Funktionsharmonik treu blieb, auf deren Grundlage er seine kontrapunktischen Monumentalbauten errichtete, wandten sich viele jüngere Kollegen den noch wenig erkundeten Feldern der Harmonik zu, auf die sie von Wagner und Debussy, aber auch von Mussorgskij und Rimskij-Korsakow, hingewiesen wurden – und von Chopin, der, obwohl großer Bach-Verehrer, als Begründer jener sich vom Wohltemperierten Clavier deutlich abhebenden Tradition der, wenn wir sie so nennen wollen, „Préludes sans fugues“ zum mehr oder weniger direkten Vorbild zahlreicher russischer Klavierkomponisten um 1900 wurde. Wie Alexander Skrjabin und Sergej Rachmaninoff, seine direkten Altersgenossen, hat sich auch der 1873 geborene Rimskij-Korsakow-Schüler Nikolai Tscherepnin ausgiebig diesem romantischen Typus der Klavierminiatur zugewandt. Die beiden Sammlungen op. 17 und op. 18 enthalten Charakterstücke verschiedenster Art in sehr gewählter Tonsprache, deren erlesene Harmonien und ungewöhnliche Fortschreitungen in entsprechend abwechslungsreicher pianistischer Faktur präsentiert werden. Zwar verbindet die Stücke eine einheitliche Grundstimmung – es dominieren mäßige Tempi und ein elegischer Tonfall – doch wiederholt sich Tscherepnin nicht und gibt jedem von ihnen ein persönliches Profil. Da steht beispielsweise die leidenschaftlich hin- und hergerissene Improvisation (op. 18/3) neben der konsequent durchgeführten Synkopenstudie (op. 18/4) und dem feierlich entrückten, sehr geschickt Glockenschall imitierenden Religioso (op. 18/4). Von diesen Beispielen russischer Fin-de-Siècle-Kultur heben sich die zweieinhalb Jahrzehnte später komponierten zwölf Stücke mit dem etwas provokanten Titel Primitifs deutlich ab. Der Komponist hat ihnen keine Opuszahl gegeben, vielleicht weil ihnen keine Melodien eigener Erfindung zugrunde liegen, sondern Volkslieder, die er einer 1810 erschienenen Sammlung entnahm. Was Tscherepnin mit diesem vorgefundenen Material macht, geht jedoch deutlich über das hinaus, was man in der Regel unter Volksliedbearbeitungen versteht. Dem Titel alle Ehre machend, arbeitet der Komponist mit „primitiven“ Gestaltungsmitteln: Es begegnen Ostinati, einfache Sätze mit Hauptstimme und Begleitung, Stimmen in schlichter Parallelführung, Heterophonie. Dabei nimmt Tscherepnin aber kaum Rücksicht auf die tonsetzerische Schulweisheit des 19. Jahrhunderts: Er steuert gezielt harte Zusammenklänge an, führt die Stimmen konsequent in dissonanten Parallelen, hebt Melodie und Begleitung rhythmisch deutlich voneinander ab und baut gelegentlich Effekte ein, die an Schlaginstrumente erinnern. Das ganze Opus ist ein Tribut an die russische Volksmusik mit ihren charakteristischen unregelmäßigen Metren, ihren stampfenden Tanzrhythmen und Glockentönen. Der Komponist, der vor der bolschewistischen Revolution nach Georgien ausgewichen war und seit 1921 im Pariser Exil lebte, ruft sich hier die Klänge seiner Heimat in ungeglätteter, rauer Naturschönheit ins Gedächtnis.
Die Stilistik der Tscherepninschen Primitifs wirkt gar nicht mehr spätromantisch und weist deutliche Parallelen zur neutonalen Ausdrucksweise der jüngeren Generation auf, womit auf ganz natürliche Weise der Bogen zu Dmitrij Schostakowitschs Préludes op. 34 geschlagen wird, diesem zurecht viel gespielten Miniatur-Wunderkabinett eines jungen Genies, das hier, noch nicht von den politischen Repressionen späterer Jahre überschattet und auf dem Höhepunkt seiner Pianistenlaufbahn stehend, seiner Phantasie unbekümmert die Zügel schießen lässt und mit wenigen Tönen treffsicher charakterisiert, auch karikiert, dramatisch zuspitzt und immer wieder den Hörerwartungen Haken schlägt.
Ein höchst anspruchsvolles Programm hat Andrea Vivanet sich bei diesem Projekt also vorgenommen – anspruchsvoll nicht nur deswegen, weil nicht wenige der hier eingespielten Stücke virtuose Fingerfertigkeit verlangen, sondern vor allem, weil so unterschiedlichen Stilen beizukommen, so viele verschiedene musikalische Charaktere adäquat darzustellen sind. Ebendies ist Vivanets Stärke. Bereits mit seinen früheren Veröffentlichungen war der Italiener, der lange in Paris lebte und zur Zeit in Georgien weilt, als ein Musiker aufgefallen, der sich mit den Werken, die er vorträgt, innig vertraut gemacht, sich in sie eingelebt hat. Hört man ihm zu, so spürt man sein Spiel jene Ruhe ausstrahlen, in welcher die Kraft liegt: eine Gelassenheit, wie sie nur einer zu vermitteln im Stande ist, der in der Musik tatsächlich jeden Winkel kennt. So wirkten unter seinen Händen die vielschichtigen Mischklänge Karol Szymanowskis überraschend luzide (Naxos), und Pjotr Tschaikowskijs Klaviersonate op. 37 klang in seiner Einspielung nicht wie das Nebenwerk eines Meisters, sondern wie das Meisterstück, das sie ist (Sheva).
Vivanet erfasst hörbar die unterschiedlichen Abschnitte eines musikalischen Verlaufs als aufeinander bezogen. Er besitzt ein untrügliches Gespür für den Auf- und Abbau harmonischer Spannung. In keinem Moment hat man bei ihm das Gefühl, der Pianist wisse nicht genau, an welchem Punkt der musikalischen Entwicklung er sich gerade befindet. So gerät ihm auch nichts beiläufig. Keine der auf dem Russischen Album aufgenommenen Miniaturen huscht einfach so vorüber. Jede erfasst Vivanet in ihrer Eigenart und arbeitet ihre Handlung mit sicherer Hand heraus.
Seine Meisterschaft des Anschlags besteht darin, für jede Situation den richtigen zu finden. Man höre etwa, wie er der Nr. 1 der Primitifs weder das marcato, noch das cantabile schuldig bleibt, rasch zwischen beiden zu wechseln versteht, dabei aber durch feinfühlige Dosierung der Kraft einen Moment des Übergangs markiert, sodass man nicht meint, ein Nacheinander bloßer Effekte, sondern die Änderung eines Zustands wahrzunehmen! Gerade bei Schostakowitsch feiert diese Kunst Triumphe. Wie reizvoll hält Vivanet im Prélude Nr. 6 in der Schwebe, ob das Stück Tanz oder Marsch, oder vielleicht doch beides zugleich ist! Wie geschickt versteht er es darzustellen, wie Nr. 9 sich unruhig hierhin und dorthin wendet, ohne sich recht entscheiden zu können; oder wie der gehetzte Walzer von Nr. 15 in gelöste, tänzerische Bewegung umschlägt und schließlich zu einem zarten Ausklang findet; oder wie Nr. 24, das groteske Spazierstückchen, es plötzlich seltsam eilig hat und sich ebenso plötzlich beruhigt, bevor es seinen alten Trott wieder aufnimmt! Ja, wie wunderbar erzählt Vivanet all diese spannenden Kurzgeschichten!
Die Begleitung einer Melodie ist für Vivanet nie etwas Unwesentliches, sondern stets eine zweite Ebene der Musik, die mit ebensolcher Sorgfalt bedacht wird wie die Hauptstimme. Welches Eigenleben die Begleitung erhalten kann, merkt man besonders, wenn sie rhythmisch der Melodie entgegengesetzt ist, wie im ersten der Tscherepninschen Morceaux op. 18. Aber auch bei einfacheren Strukturen differenziert der Pianist deutlich. In Schostakowitschs Prélude Nr. 13 meint man die Bässe von Tuben vorgetragen zu hören, während die rechte Hand Flöte spielt. Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass dialogisch angelegte Stücke wie das Sopran-Bass-Duett in Schostakowitschs Nr. 7 bei Vivanet ebenfalls in besten Händen sind. Desgleichen die Glockenstücke (Schostakowitsch Nr. 23, Tscherepnin op. 18/5), in denen das Klavier vielschichtig und vielfarbig schallen darf.
Mit einem solchen Glockengeläut markiert auch Tanejew den Höhepunkt seiner Fuge, wenn er das Thema des Präludiums aufgreift, um es ein letztes Mal prunkvoll in Szene zu setzen. Bis zu diesem Punkt ist viel passiert. Die Fuge ist eine Doppelfuge, in der das erste Thema sogleich in der Exposition vom zweiten beantwortet wird. Der kontrapunktische Wirbelwind, den Tanejew aus ihnen entfacht, kennt bis zum Schluss kein Rasten (Schalk, der er ist, lässt der Komponist das Stück nach der Klimax abrupt und leise verwehen, wie einen Windhauch) – und auch in diesem Sturm behält Vivanet souverän die Übersicht.
Muß ich noch sagen, dass ich allen Freunden kultivierten Klavierspiels Andrea Vivanets Russisches Album wärmstens empfehlen kann? Seine Darbietung der bekannten Werke Tanejews und Schostakowitschs ist schlicht mustergültig. Die Stücke Nikolai Tscherepnins werden hier erstmals überhaupt auf CD präsentiert. Das Album markiert damit auch, so steht zu hoffen, einen Wendepunkt in der Rezeption eines lange unterschätzten großen Klavierminiaturisten.
(NB: Den Umschlag zieren Abbildungen georgischer Artefakte aus dem 16. und 19. Jahrhundert, die im Beiheft durch einen kleinen „Ausstellungskatalog“ erläutert werden. Sie sind eine Hommage an den Aufnahmeort, das Georgische Staatskonservatorium in Tiflis, an welchem Nikolai Tscherepnin von 1918 bis 1921 als Direktor wirkte.)
[Norbert Florian Schuck, November 2021]