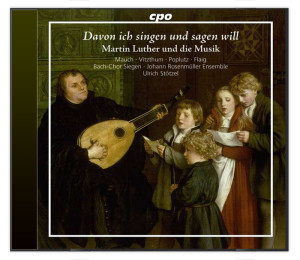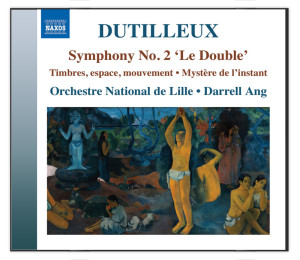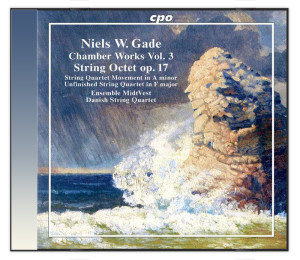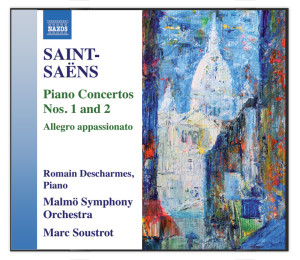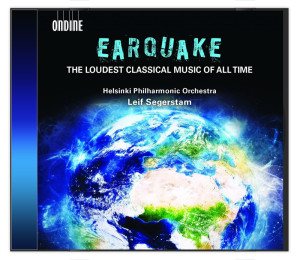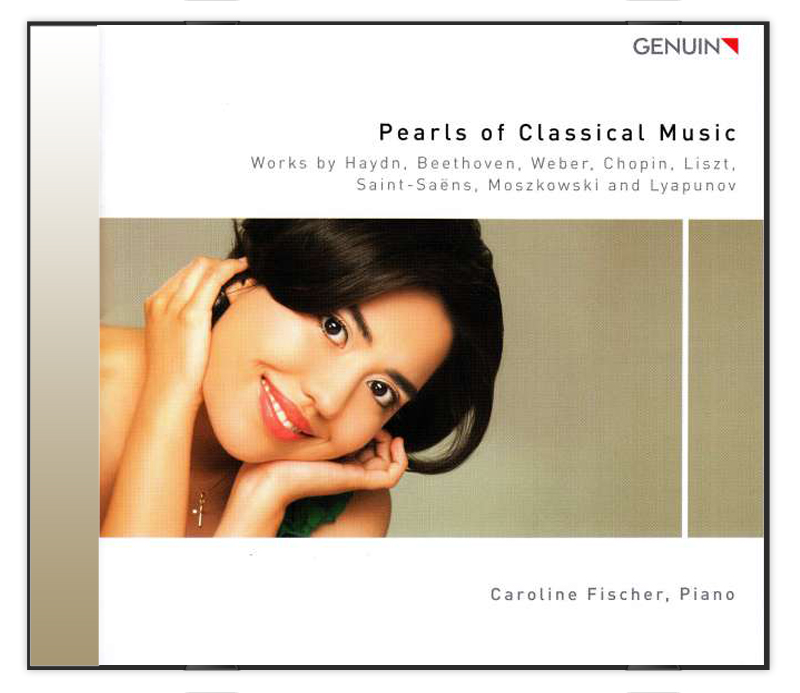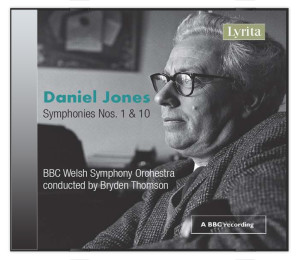Musik von Wernern Fabricius (1633-79), Martin Luther (1483-1546), Hans Neusidler (ca. 1508-63), Thomas Stoltzer (1480-1526), Johann Walter (1496-1570), Heinrich Schütz (1585-1672), Johann Eccard (1553-1611), Michael Praetorius (1571-1621), Johann Rosenmüller (1617-84), Lukas Osiander (1534-1604), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Monika Mauch, Ina Siedlaczek, Franz Vitzthum, Georg Poplutz, Nils Giebelhausen, Markus Flaig, Jens Hamann
Bach Chor Siegen – Johann Rosenmüller-Ensemble
Ulrich Stötzel
CPO 555 089 -2; EAN: 7 61203 50982 9
Rechtzeitig zum „Luther-Jahr“ erscheint diese CD, und schon auf den ersten Blick wird die unerhört spannende Bandbreite erlebbar. Von Luther selbst bis zu Bach, der sich ja in fast all seinen Kantaten sehr stark auf Luther stützt und beruft. Und wer hier etwa frömmelndes Protestantentum erwartet, wird sofort eines Besseren belehrt bzw. „be-schallt“. Nicht mit Pauken und Trompeten, aber mit Chor und Instrumenten kommt die Musik daher, so gar nicht akademisch und auch nicht historisch-hysterisch, nein, und „Jauchzet, Ihr Himmel!“ so heißt gleich das erste Stück.
Alles in allem zeigt diese CD, wie Musik zum Lutherjahr klingen kann und soll. Von Luther (1483-1546) und seinen Zeitgenossen Thomas Stoltzer (1480-1526) und Johann Walter (1496-1570) über Hans Neusidler (1508- 1563), Heinrich Schütz (1496-1570), Johann Eccard (1553-1611) und Michael Praetorius 1571-1621) bis zu Lukas Osiander (1534-1604), Johann Rosenmüller (1617-1684) – der auch dem Ensemble seinen Namen gibt – und zuletzt Johann Sebastian Bach (1685-1750) spannt sich ein weiter Bogen. Sie alle haben Luther als Ahnvater und Ideengeber. So verschiedenartig die einzelnen Stücke auch sind in Instrumentation und Gesangs- bzw. Chor-Stil, beziehen sie sich doch alle eindeutig auf den Begründer des Protestantismus. Dieser selbst hat ja auch als Musiker die Kraft der Musik sehr hoch eingeschätzt als Trägerin der Glaubensinhalte und im Gottesdienst.
Die Ausführenden haben Spaß und Lust am Musizieren, das hört man an allen Stellen, die Sängerinnen und Sänger sind textverständlich, soweit das bei derlei polyphonen Kompositionen möglich ist.
Zum Lutherjahr 2017 also auch musikalisch eine gelungene Einspielung, die so manche andere CD – wie z. B. eine ebenfalls kürzlich bei cpo erschienene mit Musik von Praetorius – um Längen hinter sich lässt
PS. Das sehr ausführliche Booklet besticht mit ausgezeichneten Informationen und den Texten der einzelnen Stücke, was ein zusätzliches Verdienst dieser CD ist.
[Ulrich Hermann April, 2017]