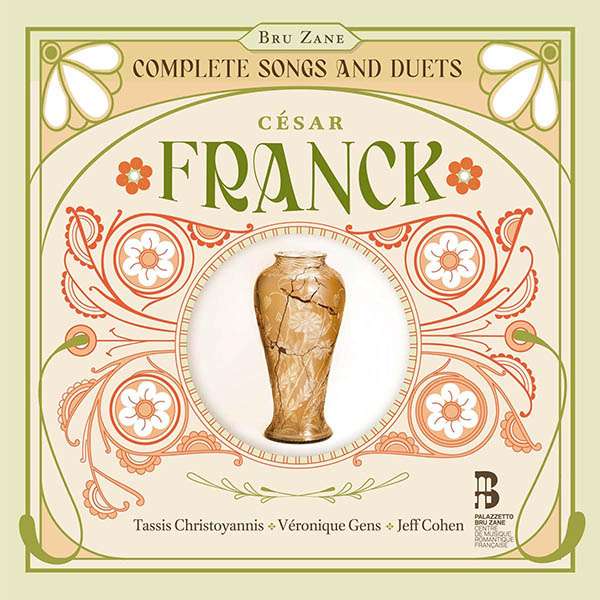Joachim Raffs 1857 vollendete Oper Samson wurde am 11. September 2022 unter Leitung Dominik Beykirchs in der Inszenierung Calixto Bietos im Deutschen Nationaltheater Weimar uraufgeführt.
Joachim Raff, mit seinen Klavier-, Kammermusik- und Orchesterwerken einer der meistgespielten Komponisten des 19. Jahrhunderts, hatte mit seinen Opern deutlich weniger Glück. Nur zwei der insgesamt sechs Werke dieser Gattung, König Alfred (UA 1851) und Dame Kobold (UA 1870), gelangten zu seinen Lebzeiten auf die Bühne, und nur Dame Kobold erwies sich als so erfolgreich, dass sie gedruckt wurde (ihre Ouvertüre wird heutzutage im Rundfunk gern gesendet). Die übrigen Opern Raffs mussten dagegen lange warten, bis sie erstmals zum Erklingen gebracht wurden. Die Parole (1868) wartet bis heute. Benedetto Marcello (1878), deren Hauptfigur der bekannte Barockkomponist ist, war 2002 auf den Herbstlichen Musiktagen in Bad Urach konzertant zu hören, wurde aber bislang nicht inszeniert. Raffs letzte Oper, Die Eifersüchtigen, die er in seinem Todesjahr 1882 schrieb, wurde vor wenigen Tagen, am 3. September 2022, im Theater Arth (Schweiz, Kanton Zug) erstmals gespielt. Den äußeren Anlass bot das 200-Jahr-Jubiläum des Komponisten, der 1822 in Lachen am Zürichsee geboren wurde. Ebenfalls aus diesem Grunde folgte nun, am 11. September, im Deutschen Nationaltheater Weimar die Uraufführung des biblischen Musikdramas Samson – und man fragt sich: „Warum erst jetzt?“
Die Geschichte des Samson zeigt einmal mehr, wie sehr das Schicksal einer Oper von Zufällen abhängen kann, und dass eine Häufung ungünstiger Ereignisse im Stande sein kann, ein Stück, das eigentlich alles hat, um auf der Bühne erfolgreich zu sein, gar nicht erst auf dieselbe kommen zu lassen. Raff begann im Jahr 1851 mit den Arbeiten an der Oper – zu einer Zeit, als er in Weimar für Franz Liszt als eine Art musikalischer Assistent tätig war und dort dessen Einsatz für die Werke Richard Wagners aus nächster Nähe miterleben konnte. Wie Wagner schrieb er sich das Libretto selbst, und vertiefte sich dazu so intensiv in die alttestamentarische Geschichte von Samson und Delilah, dass er kurzzeitig sogar daran dachte, an der Jenaer Universität über den Stoff zu promovieren. Die musikalische Ausarbeitung beendete er erst 1857 nach seiner Übersiedelung nach Wiesbaden. Gerade als er mit Franz Liszt in Verhandlungen über eine Uraufführung des Werkes in Weimar getreten war, ereignete sich dort der Skandal um Peter Cornelius‘ Barbier von Bagdad, in dessen Folge Liszt sich mit dem Hoftheater zerstritt und sein Kapellmeisteramt niederlegte. Geplante Aufführungen in Wiesbaden und Darmstadt zerschlugen sich wegen Besetzungsschwierigkeiten. Später begeisterte sich der berühmte Tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Wagners erster Tristan, für das Werk, doch starb er 1865 völlig überraschend, bevor er irgendwo eine Inszenierung hatte erreichen können. Spätestens nachdem 1877 Camille Saint-Saëns mit Samson et Dalila den gleichen Stoff erfolgreich auf die Bühne gebracht hatte, resignierte Raff – längst als Instrumentalkomponist berühmt geworden – und überließ es der Nachwelt, sich um seinen Samson zu kümmern.
Nun, da man erstmals die Gelegenheit hatte, Raffs Oper zu hören, kann man getrost sagen, dass die Zeitgenossen des Komponisten ein bedeutendes Werk verpasst haben. Bereits die Art und Weise, wie Raff den Bibelstoff dichterisch bearbeitet, zeugt vom dramatischen Talent des Autors. Die Figur der Delilah formt er gänzlich um und gewinnt dadurch Personenkonstellationen, die die Vorlage nicht hergibt. Erscheint Delilah in der Bibel als kühl berechnende und bestechliche Frau, die Samson mit voller Absicht ins Verderben lockt, so liebt sie ihn in Raffs Drama genauso wie er sie. Dadurch verschwindet die Tendenz der Vorlage: Man erlebt den Konflikt der Israeliten und Philister als neutraler Beobachter und wird nicht vom Dichterkomponisten dazu verleitet, sich auf eine Seite zu schlagen. Auch musikalisch ergreift Raff nicht Partei. Das Fest der Philister im letzten Akt hätte gewiss die Möglichkeit geboten, es als eine Art schwarze Messe zu vertonen. Die Musik ist aber schlicht festlich und fröhlich. Raff hatte kein Interesse daran, die Philister pauschal als Bösewichte zu zeichnen. Die Gewichtung liegt nicht auf den politischen, sondern auf den persönlichen Konstellationen. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Liebe zweier Menschen aus einander feindlich gesinnten Lagern – ähnlich Romeo und Julia. Samson ist, wie in der Bibel, ein bärenstarker Krieger und besiegt im ersten Akt die Philister mit Leichtigkeit. Allerdings verzichtet Raff nahezu gänzlich auf einen in der Vorlage eminent wichtigen Teil der Handlung: Wir erleben nicht, dass Delilah Samson nach den Quellen seiner Kraft ausfragt, auch fehlt dem Werk eine Szene, in der ihm die Haare (seine Energiequelle) geschnitten werden. Samson selbst ist es, der sich aus Liebe zu Delilah die Haare schneidet (was zwischen zweitem und dritten Akt passiert sein muss). Delilah hilft ihren Landsleuten nur dabei Samson gefangen zu nehmen, weil sie fürchtet, er, der sich nach seinem Sieg freiwillig am Hof der zum Frieden gezwungenen Philister aufhält, könne sie wieder verlassen. Von der Absicht ihn zu blenden, ahnt sie nichts. Da Delilah bei Raff die Tochter des Philisterkönigs Abimelech ist, ergibt sich die Möglichkeit, auch diesen als differenzierten Charakter zu gestalten: In seinem großen Monolog im zweiten Akt schwankt er, ob er sich gegen Samson verschwören, oder ihn aus Rücksicht auf das Liebesglück seiner Tochter verschonen soll. Erst der energische Einspruch seiner Heerführer und des Oberpriesters bewegt ihn dazu, Samsons Gefangennahme zu betreiben. Auch am Schluss ändert Raff die Vorlage entscheidend: Delilah verkleidet sich als israelitischer Knabe, um Samson auf dem Dagonsfest zwischen die Säulen des Tempels führen zu können. Als er den Tempel zum Einsturz bringt, stirbt sie mit ihm – auch ein Liebestod…
Dem spannungsvoll angelegten Libretto entspricht eine meisterliche musikalische Gestaltung. Jeder der fünf Akte ist pausenlos durchkomponiert und bildet eine zusammenhängende Großform, was teils durch wiederkehrende Motive unterstrichen wird. Unbestreitbar ist diese Konzeption auf Wagners Einfluss zurückzuführen. Es wäre aber eine grobe Vereinfachung, würde man Raff deswegen als einen Nachahmer Wagners bezeichnen. Verglichen mit Wagner wirken seine Melodien schlichter. Im Orchesterklang bevorzugt er hellere Farben. In der Harmonik hat er keine Angst vor kühnen Fortschreitungen, bewegt sich überhaupt auf der Höhe des im mittleren 19. Jahrhundert Erreichten, aber eigentlich „wagnerisch“ wirkt seine Handhabung der Chromatik nicht. Man tut, anstatt ihn vorschnell mit einem Etikett zu versehen, gut daran, ihn als einen durchaus eigenen Kopf zu betrachten, der die Entwicklungen seiner Zeit wachen Sinnes verfolgt, kritisch sichtet und sich davon dienstbar macht, was der Umsetzung seiner künstlerischen Pläne nützt. Im Samson muss man nicht nur die Geschlossenheit der einzelnen Akte loben, sondern auch die Steigerung zum Schluss hin. Der letzte Akt ist zugleich der musikalisch hervorragendste. Raff hat hier, in Anlehnung an die französische Große Oper, die Tempelszene als umfangreiche Ballettnummer gestaltet und mit einer Suite delikat instrumentierter, teils anmutiger, teils schwungvoller Tänze versehen, die geschickt zum katastrophalen, im wahrsten Sinne des Wortes bestürzenden Finale hinführen.
Was die musikalische Umsetzung betrifft, so können die Kräfte des Weimarer Nationaltheaters stolz auf sich sein. Die Staatskapelle Weimar unter der Leitung Dominik Beykirchs zeigte sich hochmotiviert. Besonderes Lob verdienen die während der zeremoniellen Szenen auf der Bühne spielenden Blechbläser. Emma Moore, eine sehr wandlungsfähige Sopranistin, gestaltete Delilah angemessen vielschichtig und brachte mit gleichem Geschick die zarte wie die energische Seite ihrer Figur zum Ausdruck. Uwe Schenker-Primus überzeugte als zwischen Zaudern und Handeln hin- und hergerissener Philisterkönig, ebenso Avtandil Kaspeli als mit dämonischer Energie die Handlung vorantreibender Oberpriester. Mit Peter Sonn stand für die Titelrolle ein seine Kräfte klug disponierender Tenor zur Verfügung.
Aus den Briefen, die Raff an Liszt schrieb, während er mit ihm über eine Aufführung des Samson in Weimar verhandelte, wissen wir, dass er großen Wert auf eine genaue Umsetzung seiner Vorstellungen legte. Mit Recht, denn wer sich die Mühe macht, ein psychologisch vielschichtiges Werk zu dichten und es mit dem ihm zur Verfügung stehenden großen kompositorischen Können in Musik zu setzen, der darf wohl erwarten, dass man sich zumindest bei der Uraufführung an seine Vorgaben hält. Was hätte dagegen gesprochen, dies auch 2022 zu tun? Besser als mit der Inszenierung Calixto Bieitos wäre das Theater auf jeden Fall damit gefahren. Bieito hat Raffs Werk im Grunde nur genutzt, um eine Reihe infantiler Einfälle auf die Bühne zu bringen, die sich überdies schnell abnutzen. Während in der ersten Hälfte ein Konzept noch insofern erkennbar war, als dass der Regisseur die in den Dialogen unterschwellig präsenten Machtfragen zwischen den Figuren durch gegenseitiges Prügeln und Schubsen zum Ausdruck brachte, gelegentlich auch durch Andeutungen sexueller Handlungen (die kein bisschen provokant, eher routiniert, ja beinahe prüde wirkten), so war die zweite Hälfte nach der Pause nur noch albern und ärgerlich. Wenn man am Haus kein Ballett hat, so kann man doch eine Tanzszene immer noch durch der Musik angemessene Bewegungen der Mitwirkenden sinnvoll umsetzen. Stattdessen geriet die Szene im Tempel Dagons in Bieitos Inszenierung zu einer armseligen Regietheater-Karikatur. Es wurde ein Basketball hin und her geworfen, dann setzte sich der Chor auf den Boden und fing an, lachend Plüschtiere in die Luft zu werfen. Schließlich torkelten alle Beteiligten wie besoffen im Kreis über die Bühne und schlenkerten sinnlos mit den Armen herum. Statt den Schwung der Tempeltänze zu einer interessanten Choreographie zu nutzen, wurde die Musik hier mit allen Mitteln gestört. Auch die Wirkung des Schlussakkordes wurde in Mitleidenschaft gezogen: Eigentlich war der Tempel schon eingestürzt, doch sah man Samson noch nach Verklingen der Musik am Boden kauern und sich schluchzend in Hände und Arme beißen. Was soll dieser Unsinn? Man kann dem Werk, das fraglos zum Bedeutendsten gehört, was Raff geschrieben hat, und unter den Werken der deutschen Zeitgenossen Richard Wagners einen hohen Rang beanspruchen darf, nur wünschen, dass es einmal in einer guten Inszenierung über eine Bühne geht!
[Norbert Florian Schuck, September 2022]