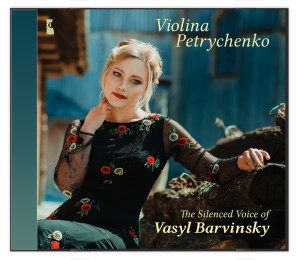Warum eigentlich so selten, und warum immer mit tschechischem Programm? Nach sechs Jahren gastierte Jiří Bĕlohlávek, der Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, erstmals wieder am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in München. Natürlich gibt es heute keinen, der wie er die Werke von Dvořák, Janáček oder Martinů meisterhaft einzustudieren vermag (nicht einmal sein einstiger Schüler Jakub Hrůsa, der neue Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, ist ihm hier ebenbürtig, aber er hat ja auch noch einige Jahre Zeit…), doch Bĕlohlávek ist heute ein so überragender Musiker, dass es mehr als bedauerlich und de facto ein Fehler ist, ihn international als Spezialisten zu konsultieren, wie dies auch seine Plattenfirma Decca sehr erfolgreich tut. Denn er ist nicht weniger großartig als Dirigent der Klassiker Mozart, Beethoven oder Schubert, und im romantischen Repertoire kennen wir ihn hier bis auf ein bisschen Mendelssohn, Brahms und Tschaikowsky überhaupt nicht. Dort er mutmaßlich ebenso Wesentliches zu sagen. Also gebt ihm doch zumindest nächstes Mal eine Mozart- oder Beethoven-Symphonie, dass er das kein wie kaum ein anderer, hat er vor allem beim Aufbau der Prager Philharmonie schlagend bewiesen.
Der Abend in der Münchner Philharmonie am Gasteig beginnt mit einem chorischen Arrangement der 2. Serenade für 2 Geigen und Bratsche von Bohuslav Martinů, einer für den Komponisten typischen, zwischen geistreichem Klassizismus und innig böhmischem Musikantentum angesiedelten kurzen Dreisätzer der dreißiger Jahre. Nach sieben Minuten ist das grazile Vergnügen vorbei, und da bleibt keine Zeit für ein Warm up der Ohren. Bĕlohlávek hat sich äußerlich verändert, ist von schwerer Krankheit gezeichnet, die zu überleben wir nicht nur ihm, sondern ganz dringend auch der ganzen Musikwelt wünschen müssen! Fein, zart, durchscheinend, mit unbestechlichem Sinn für die kontrastierenden Charaktere, absoluter Liebe und Meisterschaft in den Details, und absolut ohne jede Pose. Dieser Mann dient in seinem ganzen Wirken ausschließlich der Musik und hat in der völligen Hingabe keinen Platz für Selbstdarstellung – um den Preis, nicht zu den modischen Superstars zu gehören, denen er als Musiker ohnehin überlegen ist. Zugleich ist auch eine Veränderung in seinem Musizieren zu spüren – mit zunehmender Reifung ist das nicht zu erfassen, es hat sicher mit dem Leiden und der Krankheit zu tun, dass Bĕlohláveks Musizieren eine Gelöstheit und Luzidität vermittelt, die jenseits des geschäftigen Betriebs steht. Hier steht ein Mann, der niemandem mehr etwas beweisen will und muss, der ganz im kreativen Akt aufgeht, dessen Führung bei aller Sicherheit und Klarheit mit einer heroischen Fragilität und filigranen Natürlichkeit einnimmt, wie sie nur bei den ganz Großen zu finden sind.
Es folgt eine 1999 von Jaroslav Smolka zusammengestellte, sechssätzig umfangreiche Suite aus Leoš Janáčeks skurriler Oper ‚Die Ausflüge des Herrn Brouček’. Ein wirkliches Korrelieren zu geschlossener Ganzheit ist hier nicht möglich, da die ausgewählten Passagen nun doch zu episodisch aufeinanderfolgen. Freilich ist insbesondere der vorletzte Satz, der unter Attacken sich vorwärtsbewegende Hussiten-Choral, von herrlicher Wirkung. Und das Orchester spielt unter Bĕlohlávek großartig, mit höchster Durchsichtigkeit auch in komplexeren Fortissimo-Bereichen und dort, wo die Orchestration nicht optimal angelegt ist, um alles deutlich hervorzubringen, werden immer wieder echte Wunder vollbracht. Auch hier hat jede Einzelheit ein klares Gesicht, der Tonfall ist erstaunlich idiomatisch getroffen. Besser dürfte das unter den gegebenen Umständen nicht zu machen sein!
Nach der Pause singt Magdalena Kožená die Biblischen Lieder von Antonín Dvořák. Leider hat sie für diese zehn herrlich schlichten Lieder eine exklusiv für sie angefertigte Instrumentation mitgebracht, und man frag sich nun wirklich, was das soll. Warum spielen hier Klarinetten statt Geigen, und dort Geigen statt Flöten, und warum werden immer wieder auch konkret Töne geändert? Das alles ist zwar keine Katastrophe, aber auf jeden Fall das Gegenteil einer Verbesserung, und ich verstehe nicht so recht, warum man heute noch so etwas macht. Sicher singt sie wunderbar, sie hat einfach eine hinreißende Stimme. Ich finde aber auch, dass sie die Musik dramatischer auffasst als dem Gehalt angemessen, eher Richtung Wagner’schen Dramas als biblischer Würde. Der Erfolg beim Publikum ist freilich groß, und dass der volkstümlich sakrale Charakter der Lieder sich nicht wirklich einstellen kann, merkt dann doch nur, wer die Musik kennt oder eine klare Vorstellung davon hat. Und das ist fast niemand. Es ist auch nicht ganz einfach, Magdalena Koženás subtilen agogischen Eigenwilligkeiten zu folgen, doch hier beweits Bĕlohlávek eine souverän ruhige und reaktionsschnelle Hand. Und singen kann sie ja nun doch fraglos auf herausragendem Niveau.
Zum Schluss der grandiose Höhepunkt des Konzerts: Leoš Janáčeks dreisätzige tragische symphonische Dichtung ‚Taras Bulba’ nach Gogol. Es ist atemberaubend, wie sich selbst im dichtesten eruptiv aufgipfelnden Geflecht immer die entscheidenden Stimmen durchsetzen können, und ebenso frappierend ist, wie es Bĕlohlávek gelingt, mit klarer Vorstellung die extremen Kontraste zu sinnfällig sich entfaltendem Zusammenhang zu bündeln. Das Orchester beweist wieder einmal seine ganz große Klasse, die Aufführung wird zu einem Triumph der Musik, wie er ganz selten zu erleben ist. Schade nur, dass sich das Publikum in München für tschechische Musik des 20. Jahrhunderts nur bedingt zu interessieren scheint, der Saal also mit vielen Lücken glänzte. Dem Dirigenten lag freilich am Schluss nicht nur das Orchester, sondern auch das Publikum zu Füßen. Seit Václav Talich hat Tschechien keinen solch umfassenden Meisterdirigenten hervorgebracht. Seinen einstigen Lehrmeistern Josef Vlách und Sergiu Celibidache macht Jiří Bĕlohlávek alle Ehre. Und so überwältigend kann Leoš Janáček sein.
[Christoph Schlüren, April 2017]